
|
GENESIS, ALTES TESTAMENT: "Dann sprach Gott: Es lasse sprießen
die Erde grünende, samenhaltende Kräuter und fruchttragende
Bäume, die Früchte bringen nach ihrer Art, Früchte, die
in sich selbst ihren Samen tragen auf Erden." "So schuf Gott
die großen Seeungeheuer und all die lebenden Wesen, die sich regen,
von denen das Wasser wimmelt, nach ihren Arten, und alle beschwingten
Vögel in ihren Arten."
"So machte Gott das Wild des Feldes nach seiner Art, das Vieh nach
seiner Art und alles Gewürm, das auf dem Boden kriecht, nach seiner
Art."
"Dann sprach Gott: Lasst uns den Menschen machen als unser Ebenbild,
uns ähnlich."
"Da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub der Erde und
hauchte ihm den Odem des Lebens ins Angesicht."
CARL VON LINNÉ (1707 1778): "Es gibt so viele Arten,
wie das Unendliche Wesen im Anfang geschaffen hat."
JEAN BAPTISTE DE LAMARCK (1744 1829): "In Wirklichkeit ist
das, was wir als System der Tiere und Pflanzen bezeichnen, ein Stammbaum,
eine Ahnenreihe. Die Arten lassen sich nicht gegeneinander abgrenzen,
sie gehen ineinander über, vom einfachen Infusorium bis hinauf zum
Menschen. Die fossilen Formen des organischen Lebens sind die echten,
richtigen Vorläufer unserer heutigen Lebewesen."
GEORGES DE CUVIER (1769 1832): "Es gibt keinen fossilen Menschen."
CHARLES DARWIN (1809 1882): "Ich bin vollkommen überzeugt,
dass die Arten nicht unwandelbar sind, sondern dass die ein und derselben
Gattung angehörenden in gerader Linie von anderen, gewöhnlich
schon erloschenen Arten abstammen. Ich bin ferner überzeugt, dass
die natürliche Zuchtwahl das wichtigste, wenn auch nicht das einzige
Mittel der Veränderung gewesen ist."
TEILHARD DE CHARDIN S. J. (1881 1955): "Die Evolution des
Menschen hat ihren Höhepunkt also keinesfalls schon erreicht ...;
sie ist vielmehr in unserer Zeit in vollem Aufschwung."
WACHTTURM BIBEL UND TRAKTATGESELLSCHAFT (1968 - der kreationistische
Standpunkt): " Die natürliche Zuchtwahl oder das Überleben
des Tüchtigsten' kann im besten Falle nur die Trennung der Starken
von den Schwachen bedeuten. Aber niemals entsteht allein als Folge des
‚Überlebens des Tüchtigsten' eine neue Pflanzen oder Tierart.
Und da auch durch Mutationen keine neuen Arten entstehen, fehlen der Evolution
die Mechanismen, mit denen sie erklärt werden könnte."
"Die wahren wissenschaftlichen Tatsachen weisen nicht auf eine Entwicklung
des Menschen aus dem Tier hin, sondern darauf, dass der Mensch als eine
Art erschaffen wurde, die sich von den Tieren klar und deutlich unterscheidet."
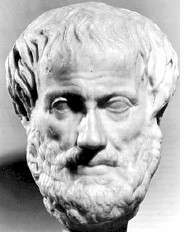 Die
griechische Biologie und die Naturwissenschaft ganz allgemein erreichten
eine Art Höhepunkt mit Aristoteles
(384 - 322 v. Chr.) Die
griechische Biologie und die Naturwissenschaft ganz allgemein erreichten
eine Art Höhepunkt mit Aristoteles
(384 - 322 v. Chr.)
Er kam aus Nordgriechenland und war der Lehrer des jungen Alexander, der
später einmal "der Große" genannt werden sollte.
Aristoteles hatte seine große Zeit in seinen mittleren Jahren, als
er das berühmte Lyzeum in Athen gründete, an dem er auch lehrte.
Er war der vielseitigste und gründlichste aller griechischen Philosophen,
der über fast alle Gegenstände schrieb, voll der Physik bis
zur Literatur, von der Politik bis zur Biologie.
Andererseits war die Biologie und besonders das Studium der Meerestiere
seine erste und liebste intellektuelle Beschäftigung. Zudem erwiesen
sich die biologischen Bücher als die besten seiner wissenschaftlichen
Arbeiten, obgleich sie in späteren Zeiten am wenigsten beachtet wurden.
Aristoteles beschrieb sorgfältig und genau Erscheinung und Eigenart
von Tieren (naturgeschichtliche Betrachtungen). Seine Liste umfasste ungefähr
fünfhundert Arten oder "Spezies" von Tieren, unter denen
er differenzierte. Das Aufstellen der Liste an sich würde noch keine
besondere Leistung gewesen sein, aber Aristoteles ging weiter. Er erkannte,
dass verschiedene Tiere in Kategorien eingeteilt werden konnten und dass
diese Gruppierung nicht unbedingt einfach und leicht durchzuführen
war. Zum Beispiel ist es leicht, die Landtiere in Vierflügler, in
fliegende und gefiederte Tiere (Vögel) und einen verbleibenden Rest
(Schädlinge) einzuteilen. Meerestiere können alle unter der
Überschrift "Fische" aufgeführt werden. Wenn man nach
dieser Methode vorgehen will, ist es jedoch nicht immer einfach zu entscheiden,
zu welcher Kategorie ein bestimmtes Tier gerechnet werden muss. Zum Beispiel
ergab sich sehr deutlich aus Aristoteles' sorgfältiger Beobachtung
des Delphins, dass dieses Tier in vielfacher und wichtiger Hinsicht einem
Fisch in keiner Weise ähnelte, obgleich eine oberflächliche
Betrachtung seines Aussehens und seiner Gewohnheiten seine Zugehörigkeit
zur Kategorie "Fisch" nahe legte. Der Delphin hatte Lungen und
atmete Luft; er würde, ganz im Gegensatz zu Fischen, ertrinken, falls
er unter der Wasseroberfläche festgehalten würde. Er war ein
Warmblütler und kein Kaltblütler wie gewöhnliche Fische.
Außerdem, und das war das Wichtigste, brachte er lebende Junge zur
Welt, die vor der Geburt durch den Mutterkuchen ernährt wurden. In
allen diesen Dingen war der Delphin den behaarten warmblütigen Tieren
des Landes sehr ähnlich. Aristoteles hielt es dieser Ähnlichkeit
wegen für notwendig, die Gruppe der Wale (Wale, Delphine) mit den
Landtieren und nicht mit den Fischen in eine Klasse zu werfen. Darin war
er seiner Zeit um zweitausend Jahre voraus, denn die Wale wurden im Altertum
und im Mittelalter zu den Fischen gerechnet.
Leeuwenhoek
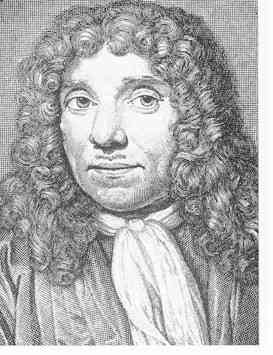 Für
den holländischen Kaufmann Anton
van Leeuwenhoek (1632 1723), war die Mikroskopie nur ein Hobby. Für
den holländischen Kaufmann Anton
van Leeuwenhoek (1632 1723), war die Mikroskopie nur ein Hobby.
Die ersten Benutzer des Mikroskops hatten Linsensysteme benutzt, die
eine stärkere Vergrößerung als eine einzelne Linse hervorbringen
konnten. Die von ihnen benutzten Linsen waren jedoch unvollkommen. Sie
besaßen auf der Oberfläche Unebenheiten und im Inneren Blasen.
Versuchte man eine zu starke Vergrößerung, dann erschienen
die Einzelheiten verschwommen.
Van Leeuwenhoek benutzte dagegen einzelne Linsen, die nur so groß
waren, dass sie aus kleinen blasenfreien Stückchen Glases hergestellt
werden konnten. Er schliff diese solange mit peinlicher Genauigkeit, bis
er klare Bilder in bis zu 200 facher Vergrößerung erhielt.
Die Linsen waren in einigen Fällen nicht größer als ein
Stecknadelkopf, reichten aber für seine Zwecke vollkommen aus.
Er sah sich alles durch seine Linsen an und konnte die roten Blutkörperchen
und die Kapillargefäße mit mehr Einzelheiten und größerer
Genauigkeit beschreiben, als frühere Entdecker Swammerdam und Malpighi
gekonnt hatten.
Am aufsehenerregendsten war jedoch die Entdeckung, die er bei der Betrachtung
von stehendem Wasser durch seine Linsen machte. Er sah winzige Gebilde,
die dem bloßen Auge verborgen blieben, die aber mit allen Anzeichen
des Lebens ausgestattet waren. Diese "Animalcules" (wie er sie
nannte) sind heute als "Protozoen" bekannt. Das Wort stammt
aus dem Griechischen und bedeutet "Urtiere".
Es wurde somit deutlich, dass nicht nur Gegenstände, sondern auch
Lebewesen von solcher Winzigkeit existierten, die mit dem nackten Auge
nicht wahrgenommen werden konnten. Ein weites und neues biologisches Gebiet
eröffnete sich hier vor den erstaunten Augen der Menschen. Das war
die Geburtsstunde der Mikrobiolgie (Untersuchung mikroskopisch kleiner
Organismen). Im Jahre 1683 erblickte Van Leeuwenhoek kaum sichtbare Lebewesen,
die noch erheblich kleiner als die Protozoen waren. Seine Beschreibungen
sind notwendigerweise undeutlich. Aber es erscheint ganz sicher, dass
sein Auge als erstes in der Geschichte das sah, was später unter
dem Namen "Bakterien" bekannt werden sollte.
Urzeugung:
Der englische Naturforscher John
Turberville Needham (1713 bis 1781), der auch gleichzeitig ein
katholischer Priester war, brachte im Jahre 1748 Hammelfleischbouillon
zum Kochen und füllte sie in eine Versuchsröhre, die er mit
einem Korken verschloss. Nach einigen Tagen wimmelte es in der Bouillon
von Mikroorganismen. Da Needham annahm, dass die vorherige Erhitzung der
Bouillon diese sterilisiert habe, folgerte er, dass die Mikroorganismen
aus totem Material entstanden seien und dass er ihre spontane Zeugung
bewiesen hätte.
Der italienische Biologe Lazzaro
Spallanzani (1729 - 99) zeigte sich gegenüber diesem Versuch
sehr skeptisch. Er glaubte, dass vor allem die Zeit der Erhitzung nicht
genügend verlängert worden sei, so dass die Bouillon nicht habe
steril werden können. Im Jahre 1768 stellte er eine Nährlösung
her, welche er zwischen einer halben und einer dreiviertel Stunde kochte.
Erst dann versiegelte er sie in einer Flasche, und nun traten keine Mikroorganismen
auf.
Klassifizierung:
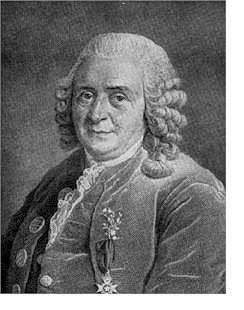 Der schwedische Naturforscher Carl
von Linne (1707 78) entwickelte eine moderne Klassifizierung der
Lebewesen. Er ist gewöhnlich unter seinem latinisierten Namen Carolus
Linnaeus bekannt. Bis zu seiner Zeit hatte sich die Anzahl der verschiedenen
Arten lebender Organismen auf mindestens 70000 erhöht. Im Jahre 1732
reiste Linnaeus Tausende Meilen kreuz und quer durch Nordskandinavien
und entdeckte in kurzer Zeit Hunderte von neuen Pflanzenarten.
Der schwedische Naturforscher Carl
von Linne (1707 78) entwickelte eine moderne Klassifizierung der
Lebewesen. Er ist gewöhnlich unter seinem latinisierten Namen Carolus
Linnaeus bekannt. Bis zu seiner Zeit hatte sich die Anzahl der verschiedenen
Arten lebender Organismen auf mindestens 70000 erhöht. Im Jahre 1732
reiste Linnaeus Tausende Meilen kreuz und quer durch Nordskandinavien
und entdeckte in kurzer Zeit Hunderte von neuen Pflanzenarten.
Noch während seines Studiums untersuchte er die Fortpflanzungsorgane
der Pflanzen, bemerkte die Formen, durch die sich diese von Art zu Art
unterschieden, und versuchte, sie auf dieser Basis zu klassifizieren.
Im Laufe der Zeit wurde dieses Vorhaben immer umfangreicher. 1735 veröffentlichte
er ein Buch mit dem Titel "Systema Naturae", in welchem er ein
Klassifikationssystem der Arten aufstellte, auf das unser heutiges zurückgeht.
Linnaeus wird daher als Begründer der Taxonomie betrachtet (das ist
die Wissenschaft von der Klassifikation der Arten von Lebewesen).
Linnaeus gruppierte systematisch ähnliche Arten in Gattungen
("genera", Einzahl "genus", von einem griechischen
Wort für Rasse). Ähnliche Gattungen wurden in "Ordnungen"
und ähnliche Ordnungen in "Klassen" zusammengefasst.
Alle bekannten Tierarten teilte er in sechs verschiedene Klassen ein:
Säugetiere, Vögel, Reptilien, Fische, Insekten und "Vermes"
(Würmer). Diese Einteilung in Hauptgruppen war (aus heutiger Sicht)
fehlerhaft, die Unzulänglichkeiten wurden später aber behoben.
Jeder Art gab Linnaeus einen lateinischen Doppelnamen. Der erste Name
bezeichnet die Gattung, der zweite die besondere Art. Diese Form der "binären
Nomenklatur" ist seit dieser Zeit beibehalten worden und hat
den Biologen für die Lebensformen eine internationale Sprache geschaffen,
die ein nicht anzugebendes Ausmaß von sonst zu erwartender Verwirrung
von vornherein beseitigt hat. Linnaeus versah sogar den Menschen mit einem
offiziellen Namen, der ihm bis heute geblieben ist "Homo sapiens".
Rudimente:
 Der
französische Naturforscher Georges
Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-88) schrieb eine sehr populäre
Enzyklopädie über Naturgeschichte. Darin führte er aus,
dass einige Lebewesen Körperteile ohne bestimmte Funktion besäßen,
wie z. B. die zwei zusammengeschrumpften Zehen, welche ein Schwein an
den Seiten seiner Klauen besitzt. Könnte es denn nicht sein, dass
diese Zehen einst ihre volle Größe besessen haben, gebraucht
worden und erst im Laufe der Zeit verkümmert sind? Könnte nicht
ganzen Organismen das gleiche beschieden gewesen sein? Könnte nicht
ein Affe ein entarteter Mensch oder ein Esel ein entartetes Pferd sein? Der
französische Naturforscher Georges
Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-88) schrieb eine sehr populäre
Enzyklopädie über Naturgeschichte. Darin führte er aus,
dass einige Lebewesen Körperteile ohne bestimmte Funktion besäßen,
wie z. B. die zwei zusammengeschrumpften Zehen, welche ein Schwein an
den Seiten seiner Klauen besitzt. Könnte es denn nicht sein, dass
diese Zehen einst ihre volle Größe besessen haben, gebraucht
worden und erst im Laufe der Zeit verkümmert sind? Könnte nicht
ganzen Organismen das gleiche beschieden gewesen sein? Könnte nicht
ein Affe ein entarteter Mensch oder ein Esel ein entartetes Pferd sein?
Der englische Arzt Erasmus Darwin (1731 - 1802) schrieb lange
Gedichte, die von Botanik und Zoologie handelten, in welchen er das Linnésche
System anerkannte. In ihnen behandelte er auch die Möglichkeit, dass
Umwelteinflüsse eine Art verändern können. Diese Ansichten
wären sicher heute längst vergessen, wenn nicht Erasmus Darwin
der Großvater von Charles Darwin gewesen wäre, mit dem die
Abstammungslehre ihren Höhepunkt erreicht hat.
Lamarck:
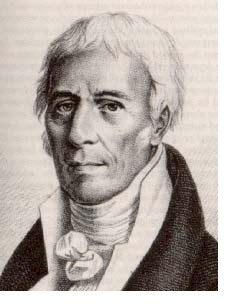 Die erste echte Evolutionstheorie stammt vom französischen Naturforscher
Jean Baptiste de Monet Chevalier
de Lamarck (1744 - 1829).
Die erste echte Evolutionstheorie stammt vom französischen Naturforscher
Jean Baptiste de Monet Chevalier
de Lamarck (1744 - 1829).
Lamarck brachte die ersten vier Klassen von Linné (Säugetiere,
Vögel, Reptilien, Fische) in die Gruppe der "Vertebraten";
das sind Tiere, die eine Wirbelsäule oder ein Rückgrat besitzen.
Die beiden anderen Klassen (Insekten und Würmer) nannte Lamarck "Invertebraten".
Lamarck erkannte, dass man in den Klassen der Insekten und Würmer
die seltsamsten Überraschungen erleben konnte. Seine Untersuchungen
führten zu einer besseren Ordnung innerhalb dieser Klassen, so dass
sein System den Stand der aristotelischen Klassifikation nicht nur erreichte
sondern auch weiter verfeinerte. Zum Beispiel bemerkte er, dass die achtfüßigen
Spinnen nicht mit den sechsbeinigen Insekten, und dass der Hummer nicht
mit dem Seestern in einer Klasse zusammengefasst werden konnte.
Von 1815 bis 1822 schuf Lamarck schließlich ein gigantisches siebenbändiges
Werk mit dem Titel "Naturgeschichte der Invertebraten",
welches die moderne Zoologie der Invertebraten begründete. Dieses
Werk hatte ihn zum Nachdenken über die Möglichkeit einer Abstammungslehre
veranlasst. Seine Gedanken über diesen Gegenstand publizierte er
schon im Jahre 1801 ausführlicher jedoch in dem 1809 erschienenen
Buch mit dem Titel "Zoologische Philosophie". Lamarck
war der Auffassung, dass sich die Leistungsfähigkeit der Organe durch
starken Gebrauch im Laufe des Lebens erhöhe und dass nichtgebrauchte
Organe verkümmerten. Diese Fortentwicklung oder Degenerierung könne
sich dann von Generation zu Generation fortpflanzen (dies wird auch oft
mit "Vererbung erworbener Eigenschaften" bezeichnet).
Die damals gerade entdeckte Giraffe benutzte er als Beispiel, um seine
Gedanken zu erläutern. Eine primitive Antilope, die gern die Blätter
der Bäume abweidet, würde ihren Nacken mit aller Kraft nach
oben recken, um so viele Blätter wie möglich zu erreichen. Zunge
und Beine würden sich dabei ebenfalls strecken. Alle diese Körperteile
würden als Resultat buchstäblich etwas länger werden, und
diese Verlängerung, so nahm Lamarck an, würde sich auf die nächste
Generation vererben. Die neue Generation würde schon mit längeren
Gliedern beginnen und diese noch weiter strecken. Schrittweise würde
sich so die Antilope in eine Giraffe verwandeln.
Geologie:
Das Jahr 1785 brachte eine Revolution. Der schottische Arzt James
Hutton (1726 - 97) betrieb Geologie als Hobby und veröffentlichte
ein Buch mit dem Titel "Theorie der Entstehung der Erdoberfläche".
In ihm machte er sich Gedanken, wie Wasser, Wind und Wetter langsam die
Erdoberfläche verändert hatten. Er behauptete, dass solche gigantischen
Veränderungen wie das Entstehen von Gebirgen, das Auswaschen von
Flusstälern und so weiter nur in ganz großen Zeiträumen
habe erfolgen können. Die Erde musste daher viele Millionen Jahre
alt sein.
Diese neue Theorie über das Alter der Erde wurde heftig bekämpft.
Man musste aber zugeben, dass dadurch die Fossilfunde, für welche
sich die Biologen eben erst zu interessieren begannen, eine Erklärung
fanden. Das Wort "Fossil" geht auf das lateinische Wort für
"ausgraben" zurück. Es wurde ursprünglich auf jeden
ausgegrabenen Gegenstand angewandt. Unter dem Ausgrabungsmaterial erregten
aber diejenigen versteinerten Objekte die größte Neugierde,
die Strukturen besaßen, welche denen lebender Organismen glichen.
Es erschien unwahrscheinlich, dass Steine gewisse Lebensformen rein zufällig
nachbilden könnten. Daher glaubten die meisten Gelehrten, Fossilien
seien auf irgendeine Weise zu Stein gewordene Lebewesen. Viele vertraten
die Ansicht, dass sie Reste von Geschöpfen seien, die bei Noahs Flut
umgekommen wären. Wenn dagegen die Erde so alt war, wie es Hutton
annahm, konnten die Fossilien außerordentlich alte Überreste
sein, bei denen die körperliche Substanz sehr langsam durch das sie
umgebende steinige Material des Erdbodens ersetzt worden war.
Durch William Smith (1769
- 1839), einen englischen Vermessungsingenieur, der Geologe wurde, erhielt
die Fossilienkunde neue Impulse. Bei der Vermessung von Kanälen hatte
er Gelegenheit, Ausgrabungen zu beobachten. Er bemerkte, wie verschiedene
Arten und Formen von Gesteinen in parallelen Ablagerungsschichten oder
Formationen angeordnet waren. Weiter fiel ihm auf, dass jede Schicht ihre
eigene charakteristische Form von Fossilüberresten hatte, die nicht
in anderen Schichten gefunden werden konnten. Wie auch immer eine solche
Schicht verlief und undeutlich wurde oder sogar dem Auge in das Erdinnere
entschwand und erst viele Kilometer entfernt wieder auftauchte, sie behielt
ihre charakteristischen Fossilien. Schließlich konnte Smith die
verschiedenen Ablagerungen durch die darin aufgefundenen Fossilien ("Leitfossilien")
identifizieren.
Katastrophentheorie:
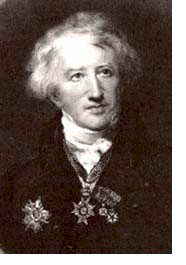 Die
Fossilienfunde erregten die besondere Aufmerksamkeit des französischen
Biologen Georges Leopold Cuvier
(1769 - 1832). Cuvier untersuchte die Anatomie verschiedener Lebewesen,
verglich sie sorgfältig und betrachtete systematisch alle Ähnlichkeiten
und Verschiedenheiten. Dadurch begründete er die vergleichende Anatomie.
Diese Studien versetzten Cuvier in die Lage, die notwendigen Beziehungen
der Körperteile so genau kennen zu lernen, dass er aus der Existenz
einiger Knochen die Gestalt anderer Knochen sowie die Art der zugehörigen
Muskeln usw. ableiten konnte. Schließlich gelang ihm eine gute Rekonstruktion
des ganzen Tierkörpers aus einer kleinen Anzahl von Teilen. Die
Fossilienfunde erregten die besondere Aufmerksamkeit des französischen
Biologen Georges Leopold Cuvier
(1769 - 1832). Cuvier untersuchte die Anatomie verschiedener Lebewesen,
verglich sie sorgfältig und betrachtete systematisch alle Ähnlichkeiten
und Verschiedenheiten. Dadurch begründete er die vergleichende Anatomie.
Diese Studien versetzten Cuvier in die Lage, die notwendigen Beziehungen
der Körperteile so genau kennen zu lernen, dass er aus der Existenz
einiger Knochen die Gestalt anderer Knochen sowie die Art der zugehörigen
Muskeln usw. ableiten konnte. Schließlich gelang ihm eine gute Rekonstruktion
des ganzen Tierkörpers aus einer kleinen Anzahl von Teilen.
Cuvier erweiterte Linnes System, indem er dessen Klassen in noch größere
Gruppen einteilte. Eine nannte er "Vertebraten", wie das schon
Lamarck getan hatte, dagegen bezeichnete er den Rest nicht mit "Invertebraten".
Vielmehr gliederte er diese in drei Gruppen: Gliederfüßler
- Schalentiere mit Gelenken, wie Insekten und Krebstiere -, Mollusken
(Muscheln und Schnecken) und Radiaten (alles übrige).
Die größten Gruppen nannte er "phyla" (Einzahl
"phylum", das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Stamm").
Seit den Tagen Cuviers ist die Anzahl der Stämme vervielfacht worden,
und man kennt bis heute im Tier- und Pflanzenreich zusammen mehr als drei
Dutzend Stämme. Insbesondere ist der Stamm der Vertebraten auf einige
primitive Tiere ohne eigentliche Wirbelsäule ausgedehnt worden und
wird heute Stamm der Chordaten genannt.
Es war wieder sein Interesse an der vergleichenden Anatomie, durch welches
Cuvier sein eigenes Klassifikationssystem auf jenen charakteristischen
Eigenschaften aufbaute, welche Beziehungen der Strukturen und ihrer Wirkungsweise
anzeigten, anstatt die oberflächlichen Ähnlichkeiten zu benutzen,
die Linne leiteten. Cuvier wandte sein Klassifikationssystem hauptsächlich
auf Tiere an.
Zwangsläufig dehnte Cuvier sein System auch auf Fossilien aus. Seinem
erfahrenen Blick - er konnte ganze Organismen aus wenigen Teilen aufbauen
- blieb es nicht verborgen, dass Fossilien nicht nur lebenden Organismen
glichen. Sie besaßen Eigenschaften, die sie eindeutig dem einen
oder anderen seiner Stämme zugehörig machten. Er konnte sie
sogar in die Untergruppen ihres entsprechenden Stammes einteilen. Dadurch
dehnte Cuvier biologisches Wissen bis in die weite Vergangenheit
aus und begründete die Wissenschaft der Paläontologie, die
vorgeschichtliche Lebensformen erforscht.
Die Fossilien schienen, wie sie von Cuvier gesehen wurden, Belege für
eine Entwicklungslehre der Arten zu sein. Je tiefer und älter ein
Fossil war, desto mehr unterschied es sich von den bestehenden Lebensformen.
Einige Fossilien konnten in eine solche Anordnung gebracht werden, dass
ein allmählicher Wandel erwiesen schien.
Da jedoch Cuvier ein frommer Mann war, konnte er die Möglichkeit
evolutionärer Veränderungen nicht akzeptieren. Stattdessen nahm
er den anderen Standpunkt ein, dass die Erde, obgleich sie sehr alt sei,
periodisch Katastrophen durchgemacht hätte, die alles Leben ausgelöscht
hätten. Nach jeder solchen Katastrophe würden neue Lebensformen
erscheinen, die sich von den vorher existierenden vollständig unterschieden.
Moderne Lebensformen (einschließlich derjenigen des Menschen) wären
nach der letzten Katastrophe entstanden. Nach dieser Ansicht musste man
keine evolutionären Prozesse annehmen, um die Fossilien zu erklären.
Die biblische Geschichte, die nur auf die Zeit nach der letzten Katastrophe
angewandt werden sollte, konnte somit unangetastet bleiben. Zur Erklärung
der Verteilung der Fossilien genügten nach Cuviers Auffassung vier
Katastrophen.
Darwin:
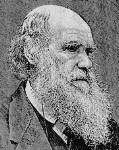 Der
Mann, der einen entsprechenden Evolutionsmechanismus beschreiben und diesem
einen festen Platz in der Vorstellungswelt der Biologen verschaffte, war
der englische Naturforscher Charles
Robert Darwin (1809 - 1882). Naturgeschichte war eines seiner
Lieblingsgebiete. Im Laufe der Studienzeit steigerte sich sein Interesse
an ihr so sehr, dass er sie als Lebensaufgabe wählte. Als 1831 die
"Beagle", ein Schiff seiner Majestät des englischen Königs,
zu einer wissenschaftlichen Expedition um die Erde bereit gemacht wurde,
bot man Darwin einen Platz als mitreisender Biologe an. Er akzeptierte.
Die Reise erstreckte sich über fünf Jahre. Obwohl Darwin von
Seekrankheit gepeinigt wurde, reifte er in dieser Zeit zu einem genialen
Naturforscher heran. Außerdem war er es, der diese Expeditionsfahrt
der "Beagle" zu einer der bedeutendsten in der Geschichte der
Biologie machte. Der
Mann, der einen entsprechenden Evolutionsmechanismus beschreiben und diesem
einen festen Platz in der Vorstellungswelt der Biologen verschaffte, war
der englische Naturforscher Charles
Robert Darwin (1809 - 1882). Naturgeschichte war eines seiner
Lieblingsgebiete. Im Laufe der Studienzeit steigerte sich sein Interesse
an ihr so sehr, dass er sie als Lebensaufgabe wählte. Als 1831 die
"Beagle", ein Schiff seiner Majestät des englischen Königs,
zu einer wissenschaftlichen Expedition um die Erde bereit gemacht wurde,
bot man Darwin einen Platz als mitreisender Biologe an. Er akzeptierte.
Die Reise erstreckte sich über fünf Jahre. Obwohl Darwin von
Seekrankheit gepeinigt wurde, reifte er in dieser Zeit zu einem genialen
Naturforscher heran. Außerdem war er es, der diese Expeditionsfahrt
der "Beagle" zu einer der bedeutendsten in der Geschichte der
Biologie machte.
Eindrucksvollsten waren die Beobachtungen, die er während seines
fünfwöchigen Aufenthaltes auf den Galapagos-Inseln, etwa 650
Meilen von der Küste Ecuadors entfernt, von der dortigen Tierwelt
machte. Er beobachtete eine Gruppe von Vögeln, die bis zum heutigen
Tag "Darwinsche Finken" genannt werden. Von diesen Finken gab
es mindestens 14 Arten, die viele verwandte Züge trugen. Keine einzige
davon kam auf dem nahe gelegenen Festland oder, soweit man wusste, sonst
irgendwo in der Welt vor. Es war für Darwin nicht sinnvoll anzunehmen,
dass vierzehn verschiedene Arten für diese kleine unscheinbare Inselgruppe
ganz allein geschaffen worden wären.
Darwin glaubte eher, dass die Finkenarten des Festlandes die Inseln lange
Zeit vorher besiedelt und deren Abkömmlinge sich allmählich
im Laufe sehr langer Zeitläufe zu den verschiedenen Arten entwickelt
hätten. Einige ernährten sich von einer bestimmten Sorte Samen,
andere von einer anderen und wiederum andere von Insekten. Jede Art entwickelte
einen ihrer Lebensweise gemäßen Schnabel, eine besondere Größe
und eine besondere Lebensordnung. Bei den ursprünglichen Finken des
Festlandes trat eine solche Entwicklung aufgrund des Existenzkampfes mit
vielen anderen Vogelarten nicht ein. Auf den Galapagos jedoch hatten die
Finken ein von anderen Vögeln verhältnismäßig unbewohntes
Land vorgefunden, das ihnen Raum für die Ausbildung vieler Arten
gab.
Ein wesentlicher Punkt blieb ungeklärt. Wodurch wurden solche evolutionären
Veränderungen bewirkt? Was machte aus einer Finkenart, die sich von
Samen ernährte, allmählich eine andere, deren Nahrung aus Insekten
bestand? Darwin konnte eine Erklärung im Lamarckschen Sinne nicht
akzeptieren, die in der Vermutung bestand, dass die Finken versucht haben
könnten, sich von Insekten zu ernähren und dann den Geschmack
daran sowie eine verbesserte Fähigkeit dazu an ihre Nachkommen weitergegeben
hätten. Leider konnte auch Darwin keine andere Erklärung dafür
finden.
Darwin war ein Perfektionist, der ein Leben lang beharrlich Informationen
sammelte und diese bis ins kleinste ordnete. Schließlich begann
er 1844 über dieses Thema zu schreiben. Jedoch selbst in den darauffolgenden
10 Jahren gelang ihm keine erschöpfende und endgültige Darstellung
dieser Theorien. 1856 endlich unternahm er einen Vorstoß.
Inzwischen hatte sich der englische Naturforscher Alfred Russel Wallace
(1823 - 1913) im Fernen Osten mit dem gleichen Problem beschäftigt.
Ebenso wie Darwin hatte auch er einen großen Teil seines Lebens
auf Reisen verbracht, darunter 4 Jahre (1848 bis -1852) in Südamerika.
1854 segelte er zur Malayischen Halbinsel und den Ostindischen Inseln.
Dort fiel ihm der große Unterschied zwischen den Säugetierarten
Asiens und Australiens auf. Später, als er über dieses Thema
schrieb, zog er eine Trennungslinie zwischen den Ländern, in denen
diese unterschiedlichen Arten gediehen. Diese Linie, die auch heute noch
die "Wallacesche Linie" genannt wird, folgt einem Tiefseekanal, der nach
Süden die großen Inseln Borneo und Celebes sowie die kleineren
Inseln Bali und Lombok trennt. Daraus ergab sich die Auffassung von der
Unterteilung der Tierarten in große kontinentale und superkontinentale
Blöcke.
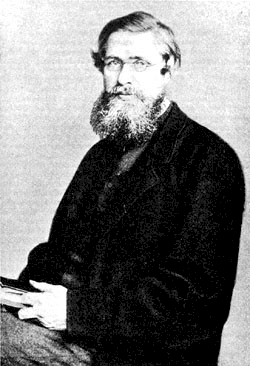 Es
schien Wallace, als ob die australischen Säugetiere primitiver
und weniger leistungsfähig als die asiatischen wären und dass
erstere in einem Existenzkampf mit diesen untergehen würden. Der
Grund dafür, dass die australischen Säugetiere überhaupt
noch existierten war die Tatsache, dass Australien und die nahegelegenen
Inseln sich vom asiatischen Festland gelöst hatten, bevor die höherentwickelten
asiatischen Arten entstanden waren. Solche Überlegungen führten
ihn zu der Vermutung einer durch natürliche Zuchtwahl bewirkten Entwicklung.
Genau wie bei Darwin reiften diese Gedanken heran, als ihm zufällig
Malthus' Buch in die Hände fiel. Wallace weilte zu dieser Zeit auf
den Ostindischen Inseln, wo er an Fieber litt. Er benutzte diese Zeit
der zwangsläufigen Muße, um seine Theorie niederzuschreiben,
wozu er zwei Tage brauchte. Es
schien Wallace, als ob die australischen Säugetiere primitiver
und weniger leistungsfähig als die asiatischen wären und dass
erstere in einem Existenzkampf mit diesen untergehen würden. Der
Grund dafür, dass die australischen Säugetiere überhaupt
noch existierten war die Tatsache, dass Australien und die nahegelegenen
Inseln sich vom asiatischen Festland gelöst hatten, bevor die höherentwickelten
asiatischen Arten entstanden waren. Solche Überlegungen führten
ihn zu der Vermutung einer durch natürliche Zuchtwahl bewirkten Entwicklung.
Genau wie bei Darwin reiften diese Gedanken heran, als ihm zufällig
Malthus' Buch in die Hände fiel. Wallace weilte zu dieser Zeit auf
den Ostindischen Inseln, wo er an Fieber litt. Er benutzte diese Zeit
der zwangsläufigen Muße, um seine Theorie niederzuschreiben,
wozu er zwei Tage brauchte.
Dann sandte Wallace das Manuskript an Darwin mit der Bitte um dessen
Stellungnahme (er wusste nicht, dass Darwin an demselben Problem arbeitete).
Als Darwin das Manuskript erhielt, war er wie vom Donner gerührt
über die große Ähnlichkeit der Ansichten. Lyell und andere
veranlassten, dass einige von Darwins Schriften zusammen mit denen von
Wallace 1858 im "Journal of Proceedings of the Linnaean Society" veröffentlicht
wurden.
 Im
folgenden Jahr schließlich veröffentlichte Darwin sein Hauptwerk "Über den Ursprung der Arten durch natürliche Selektion". Es ist im allgemeinen unter dem Titel "Der Ursprung der Arten" bekannt. Im
folgenden Jahr schließlich veröffentlichte Darwin sein Hauptwerk "Über den Ursprung der Arten durch natürliche Selektion". Es ist im allgemeinen unter dem Titel "Der Ursprung der Arten" bekannt.
1871 bekannte sich Darwin mit seinem zweiten großen Werk "The
Descent of Man" (Die Abstammung des Menschen) zum auf den Menschen
angewandten Evolutionsgedanken. Hierin besprach er die verkümmerten
Organe als typische Zeichen evolutionärer Veränderungen. (Im
menschlichen Körper gibt es einige dieser Spuren. Der Blinddarm ist
das Überbleibsel eines Organs, das einst zur Aufspeicherung von Nahrung
diente, die auf diese Weise einem bakteriengesteuerten Abbau unterworfen
werden konnte. Am Ausgangspunkt des Rückgrats befinden sich vier
Knochen, die früher Teil eines Schwanzes waren.
1856 wurde in Deutschland im Neandertal (Rheinland) eine Schädeldecke
aus der Vorzeit ausgegraben. Sie stammte mit Bestimmtheit von einem
Menschen her, war aber primitiver als die Schädeldecke irgendeines
gewöhnlichen Menschen. Entsprechend der geologischen Schicht, in
der sie gelagert hatte, musste sie viele tausend Jahre alt sein. Sofort
entspann sich eine wissenschaftliche Kontroverse. Handelte es sich um
eine frühe primitive Form des modernen Menschen, oder lediglich um
einen gewöhnlichen Wilden vergangener Zeiten, der an einer Knochenkrankheit
oder einer angeborenen Schädeldeformierung gelitten hatte?
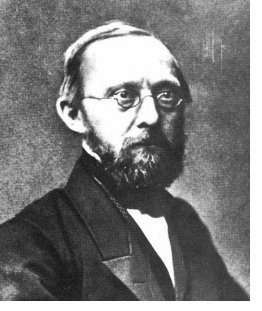 Der
Arzt Rudolf Virchow (1821 - 1902), eine außergewöhnliche
Autorität, behauptete das Letztere. Dagegen bestand der französische
Chirurg Paul Broca (1824 - 80), der berühmteste Schädelexperte
seiner Zeit, auf der Ansicht, dass kein Mensch der Gegenwart, ob krank
oder gesund, einen Schädel gleich dem des Neandertalers haben könne,
und dass dieser deshalb eine Frühform des Menschen gewesen sei, die
sich in einigen Punkten von dem modernen Menschen wesentlich unterschieden
habe. Der
Arzt Rudolf Virchow (1821 - 1902), eine außergewöhnliche
Autorität, behauptete das Letztere. Dagegen bestand der französische
Chirurg Paul Broca (1824 - 80), der berühmteste Schädelexperte
seiner Zeit, auf der Ansicht, dass kein Mensch der Gegenwart, ob krank
oder gesund, einen Schädel gleich dem des Neandertalers haben könne,
und dass dieser deshalb eine Frühform des Menschen gewesen sei, die
sich in einigen Punkten von dem modernen Menschen wesentlich unterschieden
habe.
Um diese Fragen beantworten zu können, mussten weitere Funde gemacht
werden: Fossilienfunde von fehlenden Stufen zwischen Mensch und Affe.
Unter den Fossilien waren solche so genannten "fehlenden Glieder"
keine Seltenheit.
Homo erectus:
Dem holländischen Paläontologen Marie Eugene Francois
Thomas Dubois (1858 - 1940) war bei der Suche nach den menschlichen
Vorfahren Erfolg beschieden. Besessen von der Hoffnung, das fehlende Glied
zu finden, war er der Meinung, dass in solchen Gebieten nach primitiven
menschenähnlichen Geschöpfen geforscht werden müsste, in
denen es noch Affen in großer Zahl gab. Dies war entweder in Afrika,
der Heimat des Gorillas und Schimpansen oder in Südostasien, dem
Ursprungsland des Orang-Utan und Gibbon.
1889 wurde er von der holländischen Regierung beauftragt, in Java
(damals noch in holländischem Besitz) nach Fossilien zu forschen.
Er machte sich mit großem Eifer an die Aufgabe. Innerhalb weniger
Jahre entdeckte er eine Gehirnschale, einen Hüftknochen und zwei
Zähne, die zweifellos von einem Urmenschen stammten. Die Gehirnschale
war wesentlich größer als die eines lebenden Affen und dabei
erheblich kleiner als die eines Menschen. Auch die Größe der
Zähne lag zwischen der von Menschen und Affen. Dubois nannte das
Lebewesen, zu dem diese Knochenrückstände gehörten, den
"Pithecantropus erectus" (den aufrechtgehenden Affenmenschen).
Es bestand kein begründeter Zweifel mehr an dem Tatbestand einer
menschlichen Evolution oder einer Evolution im Allgemeinen.
Mendel:
 Die
heute anerkannte Lösung des Problems ergab sich im Verlauf der Arbeiten
des österreichischen Mönchs und Botanikers Gregor
Johann Mendel (1822 - 84). Mendel war sowohl an der Mathematik
als auch an der Botanik interessiert und vereinigte beide Gebiete zur
statistischen Untersuchung von Erbsen, die sich von 1857 über acht
Jahre hinzog. Sehr sorgfältig führte er eine Selbstbestäubung
bei verschiedenen Pflanzen durch, um sich so zu vergewissern, dass eventuell
vererbte Eigenschaften nur von einem Elternteil stammen konnten. Ebenso
sorgfältig sammelte er die von jeder so befruchteten Erbsenpflanze
erzeugten Samen, pflanzte sie getrennt und beobachtete die neue Generation. Die
heute anerkannte Lösung des Problems ergab sich im Verlauf der Arbeiten
des österreichischen Mönchs und Botanikers Gregor
Johann Mendel (1822 - 84). Mendel war sowohl an der Mathematik
als auch an der Botanik interessiert und vereinigte beide Gebiete zur
statistischen Untersuchung von Erbsen, die sich von 1857 über acht
Jahre hinzog. Sehr sorgfältig führte er eine Selbstbestäubung
bei verschiedenen Pflanzen durch, um sich so zu vergewissern, dass eventuell
vererbte Eigenschaften nur von einem Elternteil stammen konnten. Ebenso
sorgfältig sammelte er die von jeder so befruchteten Erbsenpflanze
erzeugten Samen, pflanzte sie getrennt und beobachtete die neue Generation.
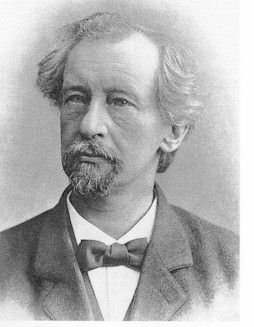 Mendel
zeigte die wesentlichen Mechanismen der biologischen Vererbung. Das war
von zentraler Bedeutung für die Evolutionstheorie. Mendel
zeigte die wesentlichen Mechanismen der biologischen Vererbung. Das war
von zentraler Bedeutung für die Evolutionstheorie.
Der holländische Botaniker Hugo de Vries (1848 - 1925)
stellte darüber Untersuchungen an. Er entdeckte zufällig auf
einer Wiese eine Kolonie gelber Nachtkerzen. Sie waren einige Zeit vorher
in Holland eingeführt worden. Den geschulten Augen des Botanikers
de Vries fiel bei ihrem Anblick folgendes auf: Einige hatten ein erheblich
anderes Aussehen als der Rest, obgleich sie doch Abkömmlinge von
den gleichen ursprünglich eingeführten Pflanzen sein mussten.
Er nahm sie mit in seinen Garten, züchtete sie getrennt und kam allmählich
zu den gleichen Schlussfolgerungen, zu denen Mendel schon ein ganzes Menschenalter
früher gelangt war. Seine Untersuchungen ergaben, dass individuelle
Merkmale von Generation zu Generation ohne Vermischung oder Ausgleich
weitervererbt wurden. Darüber hinaus stellte er fest, dass hin und
wieder eine neue Variante einer Pflanze erschien, die sich beachtlich
von den anderen unterschied und sich weitervererbte. De Vries nannte eine
solche plötzliche Veränderung Mutation (nach dem lateinischen
Wort für "Veränderung") und glaubte, dass sich vor
seinen Augen eine Evolution in Sprüngen vollzogen habe.
Bei De Vries trafen schließlich aber doch Theorie und Praxis zusammen.
Als er sich um 1900 anschickte, seine Resultate zu publizieren, fanden
seine erstaunten Augen bei der Durchsicht der Literatur über diesen
Gegenstand die vierunddreißig Jahre alte Arbeit von Mendel. 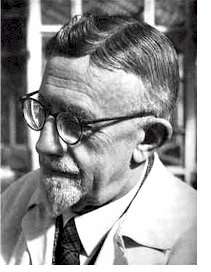 Außer
De Vries kamen noch zwei andere Forscher, der deutsche Karl Erich
Correns (1864 - 1933) und der Österreicher Erich Tschermak
von Seysenegg (1872 - 1962) im gleichen Jahr völlig unabhängig
voneinander zu Ergebnissen, die denen von De Vries sehr ähnlich waren.
Jeder von ihnen fand bei der Durchsicht der Fachliteratur die Mendelsche
Arbeit. Außer
De Vries kamen noch zwei andere Forscher, der deutsche Karl Erich
Correns (1864 - 1933) und der Österreicher Erich Tschermak
von Seysenegg (1872 - 1962) im gleichen Jahr völlig unabhängig
voneinander zu Ergebnissen, die denen von De Vries sehr ähnlich waren.
Jeder von ihnen fand bei der Durchsicht der Fachliteratur die Mendelsche
Arbeit.
Alle drei, De Vries, Correns und Tschermak von Seysenegg veröffentlichten
ihre Arbeiten im Jahre 1900, und jeder der drei zitierte die Mendelsche
Arbeit. Ihre eigenen Resultate betrachteten sie nur als Bestätigung
der Mendelschen Untersuchungen. Die Entwicklung der Genetik im 20. Jahrhundert
lieferte schließlich die Erkenntnisse, die zur Entwicklung einer
umfassenden Evolutionstheorie nötig waren. Darwins Theorie erwies
sich im Nachhinein (in den wesenlichen Vermutungen) als richtig.
|

