|
Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur in körperlichen
Merkmalen und der Fortpflanzungsfunktion, sondern auch darin, wie sie
abstrakte Aufgaben lösen - also in der Art ihrer Intelligenz.
Im Zuge der Gleichberechtigung galt und gilt es als fortschrittlich,
darauf zu bestehen, die Geschlechter seien in ihren kognitiven Fähigkeiten
nur minimal verschieden - und das auch nur aufgrund unterschiedlicher
Erfahrungen während der kindlichen Entwicklung. Die Mehrzahl der
wissenschaftlichen Befunde legt jedoch nahe, dass der Feinbau des Gehirns
bereits so früh von Sexualhormonen beeinflusst wird, dass die Umwelt
von Geburt an - und auch schon vorher - bei Mädchen und Jungen auf
unterschiedlich verschaltete Gehirne einwirkt. Das macht es nahezu
unmöglich, Erfahrungseinflüsse getrennt von der physiologischen
Disposition zu erfassen.
Verhaltensstudien sowie neurologische und endokrinologische (hormonelle)
Untersuchungen haben die Vorgänge erhellt, aus denen sich Geschlechtsunterschiede
in der Funktionsweise des Gehirns ergeben. Deren physiologische Grundlagen
hat man daher in mancherlei Hinsicht besser verstehen gelernt. Des
weiteren legen Studien über die Wirkungen von Hormonen auf die Gehirnfunktion
während der gesamten Lebensspanne nahe, dass der evolutionäre
Selektionsdruck, auf den solche Geschlechtsunterschiede letztlich zurückzuführen
sind, dennoch eine gewisse Flexibilität in den geschlechtsspezifischen
Begabungen erlaubt.
Wichtig ist festzuhalten, dass die Geschlechter zwar in spezifischen
kognitiven Fähigkeiten wesentlich zu differieren scheinen, aber nicht
in der Gesamtintelligenz (deren Höhe man häufig als Intelligenzquotienten
anzugeben versucht). Wir alle wissen, dass Menschen unterschiedliche intellektuelle
Stärken haben. Manche sind mit dem Mundwerk, andere mit den Händen
geschickter. Auch wenn zwei Individuen an sich die gleiche intellektuelle
Leistungsfähigkeit haben (den gleichen IQ), können sie doch
über jeweils andere spezifische Fähigkeiten verfügen.
Im Durchschnitt haben Männer ein deutlich besseres räumliches Vorstellungsvermögen.
Insbesondere lösen sie leichter Aufgaben, bei denen die Versuchsperson
einen Gegenstand in der Vorstellung drehen oder auf andere Weise handhaben
soll. Auch bei Tests, die mathematisches Schlussfolgern oder die Orientierung
über einen Weg verlangen, sind sie Frauen klar überlegen. Zudem schneiden
sie beim Einsatz zielgerichteter motorischer Fertigkeiten - beim Werfen
oder Auffangen von Gegenständen - besser ab.
Frauen können dafür im Allgemeinen schneller zusammenpassende
Objekte erkennen, haben gleichsam eine höhere Wahrnehmungsgeschwindigkeit.
Sie verfügen über eine höhere verbale Gewandtheit (Wortflüssigkeit);
so können sie unter anderem eher Wörter finden, die einer bestimmten
Bedingung genügen, etwa solche, die mit dem gleichen Buchstaben beginnen.
Auch sind sie den Männern bei Rechenaufgaben überlegen sowie
beim Erinnern an markante Punkte entlang eines Weges. Des Weiteren erledigen
sie bestimmte manuelle Präzisionsaufgaben rascher, zum Beispiel das
Einstecken von Stiften in vorgezeichnete Löcher auf einem Brett.
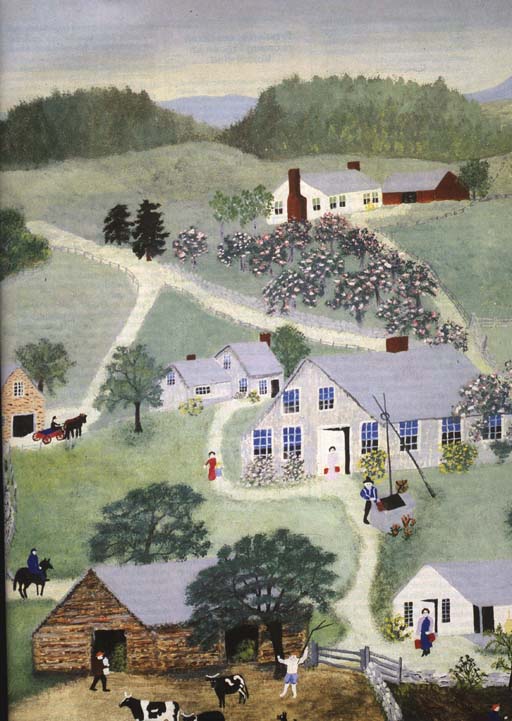
Bild: Wege in einer Landschaft wie der in dem Gemälde The Old
Oaken Bucket (Der alte Eichenholzkübel) von Grandma Moses (1860 bis
1961) werden von Frauen und Männern auf unterschiedliche
Weise gelernt. Aus Laborexperimenten weiß man, dass Frauen sich
eher an markante Punkte längs des Weges erinnern - wie hier zum Beispiel
an den Brunnen oder an den Baum an der Weggabelung. Männer hingegen
scheinen sich eine Route schneller einzuprägen, wissen dann jedoch
nicht so viele Landmarken zu nennen; sie verlassen sich bevorzugt
auf räumliche Hinweisreize wie Entfernungen und Richtungen.
Einigen Forschern zufolge treten Geschlechtsunterschiede beim Problemlösen
erst nach der Pubertät auf. Hingegen fanden Diane Lunn und ich
(Anm.: Die Autorin D. Kimura), dass schon dreijährige Jungen beim
Werfen ein Ziel besser treffen als gleichaltrige Mädchen; und Neil
V. Watson eruierte während seines Aufenthalts in meinem Labor an
der Universität von West-Ontario in London (Kanada), dass die bei
jungen Erwachsenen gefundenen Geschlechtsunterschiede beim Zielwerfen
nicht mit der jeweiligen sportlichen Erfahrung erklärbar sind. Des
Weiteren fand Kimberly A. Kerns in Zusammenarbeit mit Sheri A. Berenbaum
von der Universität Chicago (Illinois), dass bei der Fähigkeit,
sich die räumliche Drehung von Gegenständen vorzustellen, bereits
vor der Pubertät Ge-schlechtsunterschiede auftreten.
In Laborsituationen hat man systematisch untersucht, auf welche Weise
Erwachsene Wege lernen. So ließ Liisa Galea in unserem Fachbereich
Studierende auf einer großmaßstäblichen Landkarte einer
Route folgen. Die männlichen Versuchspersonen lernten den Weg in
weniger Durchgängen und machten weniger Fehler; aber nach Abschluss
des Lernvorgangs erinnerten sich die weiblichen an mehr auffällige
Einzelheiten entlang des Weges. Zusammen mit Ergebnissen anderer Untersuchungen
weist dies darauf hin, dass Frauen auch im Alltag dazu neigen, sich an
markanten Punkten zu orientieren. Die von Männern überwiegend
angewandten Strategien sind indes noch nicht eindeutig geklärt.
Marion Eals und Irwin Silverman von der York Universität in North
York (Ontario) untersuchten eine andere, aber wohl mit dem Orientierungsvermögen
zusammenhängende Gedächtnisfunktion: Die Versuchspersonen sollten
sich Gegenstände und deren Lage innerhalb eines begrenzten Raumes
- in einem Zimmer oder auf einem Tisch - merken. Frauen konnten dann besser
angeben, ob etwas versetzt worden war oder nicht. In meinem Labor maßen
wir zudem die Genauigkeit der Gegenstandslokalisierung; Frauen konnten
eine einmal gezeigte Anordnung von Gegenständen später genauer
nachbauen als Männer.
Man muss solche Unterschiede freilich im richtigen Kontext sehen: Einige
sind gering, andere recht markant. Da bei vielen kognitiven Tests, die
im Mittel Geschlechtsunterschiede aufzeigen, die Leistungen von Männern
und Frauen stark überlappen, benutzen die Forscher die Streubreite
innerhalb jeder Gruppe, um das Ergebnis zu beurteilen. Angenommen, bei
einem Test betrage der ermittelte Durchschnittswert für Frauen 105
und für Männer 100. Die Differenz wäre dann umso bedeutsamer,
je weniger sich die Streu-breiten der einzelnen Gruppen überschnitten.
Falls etwa die Einzelwerte für Frauen zwi-schen 100 und 110 variieren
und die für Männer zwischen 95 und 105, wäre das ein größerer
Geschlechtsunterschied, als wenn die Werte zwischen 50 und 150 beziehungsweise
zwischen 45 und 145 lägen.
Ein Maß für die Streuung von Einzelwerten ist die Standardabweichung.
Um die Größen des Geschlechtsunterschieds bei mehreren jeweils
anderen Aufgaben vergleichen zu können, teilt man die Differenz der
Durchschnittswerte der beiden Geschlechtergruppen durch die Standardabweichung.
Ist der resultierende dimensionslose Zahlenwert - die Effektstärke
- kleiner als 0,5, wird allgemein der Unterschied als gering eingeschätzt.
Nach meinen Daten bestehen zum Beispiel keine charakteristischen Unterschiede
zwischen Männern und Frauen bei Wortschatztests (Effektstärke
0,02), nicht verbalem Schlussfolgern (0,03) sowie verbalem Schlussfolgern
(0,17). Gilt es aber, Bilder zuzuordnen, Wörter mit ähnlichen
Anfangsbuchstaben zu finden oder gedankliche Beweglichkeit (Ideenflüssigkeit)
zu demonstrieren, etwa weiße oder rote Gegenstände aufzuzählen,
sind die Effektstärken etwas größer: 0,25, 0,22 und 0,38
und zwar sind, wie er-wähnt, bei diesen Aufgaben die Frauen eher
überlegen. Die größten Effektstärken wur-den in bestimmten
Tests der mentalen Rotation von Gegenständen (0,7) und der motori-schen
Zielgenauigkeit (0,75) festgestellt, wobei die höchsten Einzelwerte
hauptsächlich Männer erzielten.
Differenzierung der Geschlechter
 Wie
aber entstehen solche Unterschiede, wenn doch - mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen
- alle Menschen die gleiche genetische Basis haben? Höchstwahrscheinlich
spiegeln die spezifischen Fähigkeiten von Männern und Frauen
verschiedene hormonale Einflüsse auf das sich entwickelnde Gehirn
wider. Wie
aber entstehen solche Unterschiede, wenn doch - mit Ausnahme der Geschlechtschromosomen
- alle Menschen die gleiche genetische Basis haben? Höchstwahrscheinlich
spiegeln die spezifischen Fähigkeiten von Männern und Frauen
verschiedene hormonale Einflüsse auf das sich entwickelnde Gehirn
wider.
Bereits in einer frühen Embryonalphase leiten Östrogene und
Androgene (die weiblichen und männlichen Sexualhormone) eine geschlechtliche
Differenzierung ein. Bei Säugern - einschließlich des Menschen
- ist der Embryo zunächst so angelegt, dass er ebenso gut männlich
wie weiblich werden könnte: mit zwei Wolffschen und zwei Müllerschen
Gängen, die sich erst später zu männlichen beziehungsweise
weiblichen inneren Geschlechtsorganen entwickeln.
Enthielt die befruchtete Eizelle außer dem X- auch ein Y-Chromosom,
so bilden sich beim menschlichen Embryo gegen Ende des zweiten Monats
männliche Keimdrüsen - die Hoden - aus; das ist der kritische
erste Schritt für die Entwicklung zum Mann. Normalerweise beginnen
die Hoden männliche Hormone zu produzieren, die für die körperliche
Ausprägung des Geschlechts beim Embryo nötig sind: Testosteron
lässt aus den Wolffschen Gängen Samenleiter und Samenblase entstehen
und bewirkt - indirekt nach Umwandlung in Dihydrotestosteron (DHT) - die
Bildung von Hodensack und Penis. Das Anti-Müller-Hormon veranlasst
die Rückbildung der Müllerschen Gänge, die sich ohne dieses
Regressionshormon zu Eileiter und Gebärmutter entwickelt hätten.
(Bilden die Hoden keine männlichen Hormone oder können diese
nicht auf das Zielgewebe wirken, so entsteht - sozusagen als Grundform
- ein weiblicher Organismus. Störungen während der Differenzierung
des männlichen Geschlechts können eine unvollständige Maskulinisierung
des Fetus zur Folge haben, obgleich das Erbmaterial in allen Zellen das
Y-Chromosom enthält.)
Die Geschlechtshormone bewirken jedoch nicht nur die Ausprägung
männlicher Geschlechtsorgane, sondern noch mehr: Sie leiten schon
früh Differenzierungen im Gehirn ein, die später für das
Auftreten entsprechender männlicher Verhaltensweisen wichtig sind.
Da wir das hormonale Geschehen insbesondere beim noch ungeborenen Menschen
nicht manipulieren können, beruht vieles von dem, was wir im einzelnen
über die frühe Determinierung des Verhaltens wissen, auf Untersuchungen
an Tieren. Auch bei diesen tendiert die Entwicklung zu weiblichen
Verhaltensmustern, wenn der maskulinisierende Einfluss der Hormone fehlt.
 Wenn
man ein Nagetier - etwa eine Ratte - mit ausgebildeten männlichen
Genitalien unmittelbar nach der Geburt der Androgene beraubt (entweder
durch Kastration oder durch Verabreichen eines Präparats, das diese
Hormone blockiert), zeigt es später weniger der männlichen sexuellen
Verhaltensweisen wie zum Beispiel Aufreiten, dafür mehr der weiblichen,
zum Beispiel Lordosis (Emporrecken des Hinterteils). Erhält umgekehrt
ein Weibchen unmittelbar nach der Geburt Androgene verabreicht, zeigt
es als erwach-senes Tier mehr männliches als weibliches Sexualverhalten. Wenn
man ein Nagetier - etwa eine Ratte - mit ausgebildeten männlichen
Genitalien unmittelbar nach der Geburt der Androgene beraubt (entweder
durch Kastration oder durch Verabreichen eines Präparats, das diese
Hormone blockiert), zeigt es später weniger der männlichen sexuellen
Verhaltensweisen wie zum Beispiel Aufreiten, dafür mehr der weiblichen,
zum Beispiel Lordosis (Emporrecken des Hinterteils). Erhält umgekehrt
ein Weibchen unmittelbar nach der Geburt Androgene verabreicht, zeigt
es als erwach-senes Tier mehr männliches als weibliches Sexualverhalten.
Bruce S. McEwen und seine Mitarbeiter an der Rockefeller Universität
in New York haben herausgefunden, dass bei der normalen Entwicklung von
männlichen Ratten sich die zwei Prozesse Defeminisierung und Maskulinisierung
aufgrund etwas unterschiedlicher biochemischer Veränderungen und
zu etwas verschiedenen Zeiten abspielen. Das Androgen Testosteron kann
entweder in Östrogen (das üblicherweise als ein weibliches Hormon
gilt) oder in Dihydrotestosteron umgewandelt werden. Nach McEwen erfolgt
die Defeminisierung bei den genetisch männlichen Ratten im wesentlichen
nach der Geburt und wird durch Östrogen vermittelt, wohingegen die
Maskulinisierung sowohl Dihydrotestosteron als auch Östrogen erfordert
und größtenteils schon vor der Geburt stattfindet. Bei den
weiblichen Jungtieren schützt wohl eine als Alpha-Fetoprotein bezeichnete
Substanz das Gehirn vor den maskulinisierenden Wirkungen des körpereigenen
Östrogens.
Die Gehirnregion, die das weibliche und männliche Fortpflanzungsverhalten
steuert, ist der Hypothalamus. Diese kleine Struktur im Zwischenhirn ist
mit der (beim Menschen gerade erbsengroßen) Hypophyse verbunden,
einer übergeordneten endokrinen Drüse. Wie Roger A. Gorski und
seine Kollegen von der Universität von Kalifornien in Los Angeles
gezeigt haben, ist der mediale Nucleus praeopticus, eine Region des Hypothalamus,
bei männlichen Ratten deutlich sichtbar größer als bei
weiblichen. Der Größenzuwachs bei den Männchen wird durch
die Anwesenheit von Androgenen unmittelbar nach der Geburt begünstigt
(vorher in schwächerem Maße). Gorskis Mitarbeiterin Laura S.
Allen fand einen ähnlichen strukturellen Geschlechtsunterschied im
menschlichen Gehirn. (Aber anders als bei Ratten erfolgt die sexualhormonabhängige
Differenzierung des Thalamus beim Menschen schon während der Fetalentwicklung.
)
Andere noch vorläufige, aber faszinierende Befunde lassen vermuten,
dass sich weitere anatomische Unterschiede im menschlichen Sexualverhalten
niederschlagen könnten. Im Jahre 1991 berichtete Simon LeVay vom
Salk-Institut für Biologie in San Diego, dass eine der Gehirnregionen,
die normalerweise bei Männern größer ist als bei Frauen
- ein interstitieller Kern des vorderen Hypothalamus -, bei homosexuellen
Männern kleiner sei als bei heterosexuellen. LeVay zufolge stützt
dies Vermutungen, dass sexuelle Vorlieben auf einem biologischen Substrat
beruhen.
Homo- und heterosexuelle Männer können bei bestimmten kognitiven
Tests durchaus unterschiedliche Leistungen zeigen. Brian A. Gladue von
der Staatsuniversität von North Dakota in Fargo und Geoff D. Sanders
vom Polytechnikum der Stadt London (England) berichten, dass Homosexuelle
bei einigen räumlichen Aufgaben, ähnlich wie die Frauen, schlechter abschneiden. Zudem stellte
mein Mitarbeiter Jeff Hall kürzlich fest, dass Homosexuelle beim
Zielen geringere Testwerte erreichten; hingegen waren sie heterosexuellen
Männern in der Ideenflüssigkeit - dem Aufzählen von Gegenständen
bestimmter Farbe - überlegen.
Die Arbeiten in diesem spannenden Forschungsgebiet haben gerade erst
begonnen. Wichtig ist dabei darauf zu achten, wie stark der persönliche
Lebensstil zu Gruppenunterschieden beiträgt. Andererseits stellen
eventuell gefundene Gruppenunterschiede lediglich allgemeine statistische
Aussagen dar; sie bestimmen einen Durchschnitt, von dem jedes Individuum
abweichen kann. Solche Untersuchungen versprechen jedenfalls reiche Informationen
über die physiologischen Grundlagen spezifischer kognitiver Leistungen.
Sexualhormone und Verhalten
Die Einwirkung von Sexualhormonen in einer frühen, kritischen
Lebensphase scheint die Organisation des Gehirns auf irreversible Weise
zu beeinflussen. Das Verabreichen derselben Hormone in einer späteren
Phase hat keinen solchen Effekt. Ihre Wirkung scheint freilich nicht
nur Sexualität und Fortpflanzung, sondern alles Verhalten zu betreffen,
in denen sich die Geschlechter unterscheiden - die Art des Problemlösens
ebenso wie die Aggressivität und die Neigung zu spielerischem Kampfverhalten
bei den jungen Männchen vieler Säugetierarten. So fand Michael
J. Meaney von der McGill-Universität in Montreal (Kanada), dass bei
jungen männlichen Nagern Dihydrotestosteron über den Mandelkern
- die Amygdala - und nicht über den Hypothalamus das spielerische
Kampfverhalten auslöst. (Der Mandelkern liegt an der Innenseite des
Schläfenlappens, der der jeweils anderen Hirnhälfte zugewandt
ist.)
Auch männliche und weibliche Ratten haben verschiedene Problemlösestrategien.
Christina L. Williams vom Barnard-College fand, dass die weiblichen stärker
dazu neigen, beim Wegelement markante Punkte zu beachten - so wie es Frauen
zu tun scheinen: Sie orientieren sich mehr an Hinweisreizen wie Mustern
an den Wänden des Test-Labyrinths als an geometrischen Charakteristika
wie Winkeln und Form der Gänge. Wenn keine bildlichen Landmarken
vorhanden waren, benutzten die weiblichen Tiere allerdings - wie es die
Männchen nahezu ausschließlich taten - die geometrischen Hinweisreize.
Interessanterweise bewirkt eine hormonale Intervention während
der kritischen Zeitspanne, also der Entzug von Testosteron etwa durch
Kastration bei neugeborenen Männchen beziehungsweise das Verabreichen
von Östrogen an neugeborene Weibchen, eine völlige Umkehrung
des geschlechtstypischen Verhaltens der erwachsenen Tiere.
Wie bereits erwähnt, kann Östrogen während der Gehirnentwicklung,
die bei neugeborenen Ratten nicht abgeschlossen ist, eine maskulinisierende
Wirkung auf das Gehirn haben; das erklärt, weshalb dann die weiblichen
Tiere sich wie Männchen verhalten.
Die normalerweise vorhandenen Unterschiede im Orientierungs- und Wegfindeverhalten
könnten sich im Laufe der Evolution im Zusammenhang mit Fortpflanzungsstrategien
herausgebildet haben. Steven J. C. Gaulin und Randall W. Fitzgerald von
der Universität Pittsburgh (Pennsylvania) argumentieren, dass Wühler-Männchen,
die mehrere Weibchen begatten, größere Reviere durchwandern
müssen als die Weibchen. Deshalb scheine eine besondere Orientierungsfähigkeit
für ihren Fortpflanzungserfolg kritisch zu sein. Tatsächlich
fanden die beiden Forscher in Labyrinth-Untersuchungen Geschlechtsunterschiede
nur bei polygynen Wühlern, wie der Wiesenmaus, nicht bei monogamen
Arten wie der Präriemaus.
Wiederum scheinen Verhaltensunterschiede mit strukturellen einherzugehen.
Lucia F. Jacobs hat in Gaulins Labor herausgefunden, dass der Hippocampus
- eine Region, die vermutlich sowohl bei Vögeln als auch bei Säugern
am räumlichen Lernen beteiligt ist - bei polygynen männlichen
Wühlern größer ist als bei den Weibchen. Wie es sich damit
beim Menschen verhält, ist noch nicht bekannt.
Auch der Einfluss von Sexualhormonen auf das Verhalten Erwachsener lässt
sich beim Menschen nicht so direkt erfassen oder experimentell angehen.
Die Forscher beziehen sich vielmehr auf mögliche Parallelen zu anderen
Spezies sowie auf spontan auftretende Ausnahmen von der Norm.
Besonders aufschlussreich sind Untersuchungen an Mädchen, die
im Mutterleib oder als Neugeborene einem Übermaß an Androgenen
ausgesetzt waren. Die Ursache kann ein genetischer Defekt sein, der
eine angeborene Vergrößerung der Nebennieren verursacht; zudem
gab es solche Fälle vor den siebziger Jahren, als Schwangere mit
verschiedenen synthetischen Steroiden behandelt wurden. Die Vermännlichung
der äußeren Geschlechtsorgane beim weiblichen Fetus infolge
des Hormonüberschusses kann zwar recht früh nach der Geburt
mittels plastischer Chirurgie korrigiert und die Überproduktion der
Androgene durch eine medikamentöse Behandlung gedrosselt werden,
die Auswirkungen auf das Gehirn lassen sich jedoch nicht mehr umkehren.
Untersuchungen von Forschern wie Anke A. Ehrhardt von der Columbia Universität
in New York und June M Reinish vom Kinsey-Institut in Bloomington (Indiana)
haben ergeben, dass Mädchen mit übermäßiger Androgenexposition
als Heranwachsende außergewöhnlich wild und aggressiv sind.
Dies wurde allerdings nur aus Interview mit den betroffenen Mädchen
und derer Müttern, aus Beurteilungen von Lehrern oder aus Fragebögen
gefolgert, welche die Mädchen selbst ausfüllten; mithin sind
Einflüsse durch Erwartungen des Erwachsenen, denen die Lebensgeschichte
des jeweiligen Mädchens bekannt ist, oder der Mädchen selbst
schwer auszuschließen.
Deshalb sind die objektiven Untersuchungen von Sheri Berenbaum und
Melissa Hines von der Universität vor Kalifornien in Los Angeles
überzeugender. Sie beobachteten das Spielverhalten von betroffenen
Mädchen und verglichen es mit dem ihrer männlichen und weiblichen
Geschwister.
Von einer Auswahl an Autos und Baukästen, Puppen
und Puppenküchen, Büchern und Brettspielen bevorzugten diese
Mädchen das eher typisch maskuline Spielzeug; und sie beschäftigten
sich beispielsweise mit Autos ebenso lange wie normale Jungen. Sie unterschieden
sich bei der Auswahl von Spielzeug gleichermaßen wie die Jungen
von den nicht betroffenen Mädchen. Da anzunehmen ist, dass die
Eltern diese Töchter mindestens ebenso zu typisch weiblichem Verhalten
ermuntern wie deren nicht betroffene Schwestern, legen diese Befunde nahe,
dass die Spielzeugpräfe-renz tatsächlich auf gewisse Weise durch
die frühen hormonalen Einflüsse verändert worden ist.
Auch
das räumliche Vorstellungsvermögen - üblicherweise beim
männlichen Geschlecht besser ausgebildet - ist bei Mädchen,
die früh einem Übermaß an Androgenen ausgesetzt waren,
betont.
Susan M. Resnick, Sheri Berenbaum und ihre Kollegen berichteten, dass
sie ihren nicht betroffenen Schwestern bei Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen
sowie bei der Aufgabe, einfache Formen aus einer Vielzahl überlagerter
Strukturen herauszufinden, überlegen waren. Darin sind sonst männliche
Versuchspersonen im Durchschnitt besser als weibliche. Bei anderen Tests
zur Wahrnehmung, zu verbalen Fähigkeiten und zum Schlussfolgern gab
es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.
Hormonspiegel und kognitive Leistungen.
Aus diesen und ähnlichen Untersuchungen könnte man schließen,
das räumliche Vorstellungsvermögen sei generell umso besser,
je höher der Androgenspiegel ist. Dem scheint aber nicht so. Im Jahre
1983 fand Valerie J. Shute, damals an der Universität von Californien
in Santa Barbara, Hinweise auf einen nicht linearen Zusammenhang: Sie
bestimmte bei Studenten und Studentinnen den Androgengehalt im Blut. Die
Werte streuten zwar über einen Bereich, der für das jeweilige
Geschlecht typisch ist (auch bei Frauen sind männliche Hormone vorhanden,
wenn auch nur in sehr geringer Menge); und als Valerie Shute jede Geschlechtergruppe
weiter in Untergruppen mit hohem und niedrigem Androgenspiegel einteilte,
fand sie, dass Frauen mit hohem Androgenspiegel bei räumlichen Tests
besser abschnitten als solche mit niedrigem. Aber bei den Männern
galt das Umgekehrte: Solche mit niedrigem Androgenspiegel zeigten bessere
Leistungen.
Catherine Gouchie und ich führten kürzlich eine ähnliche
Untersuchung durch. Wir bestimmten den Testosterongehalt im Speichel und
testeten nicht nur das räumliche Vorstellungsvermögen, sondern
auch das mathematische Schlussfolgern und die Wahrnehmungsgeschwindigkeit.
Unsere Ergebnisse bei den räumlichen Tests ähnelten denen von
Valerie Shute: Männer mit wenig Testosteron waren ihren Geschlechtsgenossen
mit viel Testosteron überlegen, während bei den Frauen mehr
Testosteron mit besseren Leistungen korreliert war. Solche Befunde lassen
vermuten, dass es sozusagen einen optimalen Androgenspiegel gibt, bei
dem das räumliche Vorstellungsvermögen am besten ist; er müsste
dann etwa im unteren Teil des für Männer typischen Streubereichs
liegen.
Keine Korrelation konnten wir zwischen dem Testosteronspiegel und der
getesteten Wahrnehmungsgeschwindigkeit finden. Für das mathematische
Schlussfolgern war bei den Männern der Befund hingegen ähnlich
wie der bei den Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen: Diejenigen
mit wenig Androgen erreichten höhere Testwerte als solche mit viel
Testosteron; bei den Frauen indes war keine Korrelation erkennbar.
Diese Resultate sind mit der Hypothese von Camilla P. Benbow von der
Staatsuniversität von Iowa in Ames vereinbar, wonach die mathematische
Begabung in hohem Maße von einer biologischen Determinante abhängt.
Sie und ihre Kollegen haben eine deutliche Überlegenheit der männlichen
Versuchspersonen beim mathematischen Schlussfolgern festgestellt - und
zwar im oberen Bereich der Streubreite besonders ausgeprägt, wo Männer
und Frauen im Verhältnis 13:1 vertreten sind. Camilla Benbow meint,
diese Geschlechtsunterschiede seien nicht leicht durch soziale Effekte
erklärbar.
Man muss beachten, dass es sich bei der Beziehung zwischen natürlichem
Hormonspiegel und Problemlöseverhalten um eine Korrelation von Messdaten
handelt. Irgendwie ist beides verknüpft, aber welche Faktoren dafür
bestimmend sind oder was die Ursache sein könnte, ist nicht bekannt.
Noch wissen wir zu wenig über die Beziehung zwischen dem Hormonspiegel
beim Erwachsenen und dem in den frühen Entwicklungsphasen, in denen
offensichtlich die Voraussetzungen für spezifische Fähigkeiten
im Nervensystem organisiert werden. Es gilt noch viel herauszufinden über
die genauen Mechanismen, die den spezifischen kognitiven Leistungen beim
Menschen zugrunde liegen.
Befunde an Hirngeschädigten
Ein anderer Ansatz, Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen
Gehirnen aufzuspüren, ist, die Arbeitsweise bestimmter Hirnstrukturen
zu prüfen und zu vergleichen. Dies ist ohne Eingriffe möglich,
wenn eine spezifische Gehirnregion geschädigt ist. Derartige Untersuchungen
weisen darauf hin, dass bei den meisten Menschen die linke Hirnhälfte
für die Sprache wesentlich ist und die rechte für bestimmte
wahrnehmungs- und raumbezogene Funktionen.
Viele Forscher, die Geschlechtsunterschiede untersuchen, nehmen an, dass
die beiden Hirnhälften bei Männern für Sprache und räumliches
Vorstellungsvermögen stärker asymmetrisch organisiert seien
als bei Frauen. Für diese funktionelle Asymmetrie gibt es mehrere
Hinweise. Teile des Balkens (Corpus callosum), des größten
Nervenfaserbündels, das die beiden Hemisphären verbindet, können
bei Frauen ausgedehnter sein; Wahrnehmungsfunktionen, anhand derer man
Hirnasymmetrien bei Personen mit ge-sundem Gehirn untersuchen kann, sind
mitunter bei Frauen in geringerem Maße auf eine Hemisphäre
beschränkt, und Verletzungen einer Hirnhälfte haben bei ihnen
manchmal geringere Auswirkungen als vergleichbare Schädigungen bei
Männern.
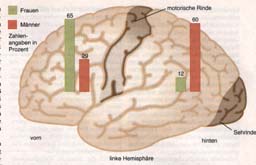 |
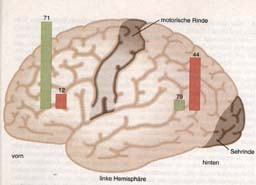 |
Aphasien (Sprachstörungen bei der Wortwahl
etwa) treten bei Frauen am häufigsten auf, wenn vordere Teile
des Gehirns verletzt sind. Bei Männern sind sie häufiger
bei Läsionen der hinteren Bereiche (links). |
Apraxien (Schwierigkeiten, angemessene Handbewegungen
zu wählen) werden bei Frauen hauptsächlich bei Schädigungen
der vorderen linken Hirnhälfte hervorgerufen und bei Männern
bei solchen der hinteren Regionen (rechts). Sie gehen zudem mit Sprachstörungen
einher. |
Im Jahre 1982 berichteten Marie Christine de Lacoste, die jetzt an der
Medizinischen Fakultät der Yale Universität in New Haven (Connecticut)
arbeitet, und Ralph L. Holloway von der Columbia Universität in New
York, dass das hintere Drittel des Balkens - das Splenium, das visuelle
Information zwischen den Hirnhälften überträgt - bei Frauen
größer sei als bei Männern. Dieser Befund ist in der Folge
sowohl bestritten als auch bestätigt worden. Formveränderungen
des Balkens, die während der Alterung eines Individuums auftreten
können, wie auch unterschiedliche Messverfahren mögen zu dem
Dissens beigetragen haben. Erst kürzlich fanden aber auch Allen und
Gorski den gleichen geschlechterbezogenen Größenunterschied
beim Splenium.
Das Interesse am Balken erklärt sich aus der Vermutung, seine Größe
könnte die Anzahl der Nervenfasern anzeigen, die beide Hirnhälften
verbinden. Wären bei einem Geschlecht mehr davon vorhanden, müsste
man nämlich daraus schließen, dass die beiden Hemisphären
eingehender miteinander kommunizierten. Und von Ratten ist zudem bekannt,
dass Sexualhormone die Größe des Balkens verändern können;
dies haben Victor H. Denenberg und seine Mitarbeiter von der Universität
von Connecticut in Storrs ermittelt. Indes ist noch nicht geklärt,
ob die tatsächliche Anzahl an Fasern bei den Ge-schlechtern differiert.
Des weiteren bleibt die mögliche Beziehung zwischen kognitiven Geschlechtsunterschieden
und der Größe des Balkens zu prüfen. Neue Verfahren zur
bildlichen Darstellung des Gehirns beim lebenden Menschen werden sicherlich
weiterhelfen.
Die Auffassung, das männliche Gehirn weise eine größere
funktionelle Asymmetrie auf als das weibliche, hat eine lange Tradition.
Albert Galaburda vom Beth Israel Hospital in Boston (Massachusetts) und
Norman Geschwind von der medizinischen Fakultät der Harvard Universität
im benachbarten Cambridge hatten vermutet, dass Androgene das funktionelle
Vermögen der rechten Hemisphäre steigerten. Tatsächlich
fand im Jahre 1981 Marian C. Diamond von der Universität von Kalifornien
in Berkeley, dass bei männlichen Ratten die rechte Hirnrinde (der
rechte Cortex) dicker ist als die linke, nicht aber bei Weibchen. Jane
Stewart von der Concordia Universität in Montreal (Kanada) bestimmte
kürzlich in Zusammenarbeit mit Bryan E. Kolb von der Universität
Lethbridge (Kanada) die hormonalen Einflüsse auf diese Asymmetrie
in der frühen Entwicklungs-phase genau: Androgene scheinen demnach
das Wachstum der linken Hirnrinde zu hemmen.
1991 legten Marie Christine de Lacoste und ihre Kollegen einen ähnlichen
Befund an menschlichen Feten vor: Bei männlichen war die rechte Hirnrinde
größer als die linke. Mithin scheint es durchaus einige anatomische
Belege für die Annahme zu geben, dass die beiden Hemisphären
bei Männern und Frauen nicht gleichermaßen asymmetrisch sind.
Die Indizien sind allerdings noch dürftig und widersprüchlich
- was nahelegt, dass die auffälligsten Geschlechtsunterschiede in
der Gehirnorganisation vielleicht gar nicht mit der funktionellen Asymmetrie
zusammenhängen.
Falls beispielsweise die Gesamtunterschiede in der Raumwahrnehmung zwischen
Männern und Frauen auf der unterschiedlichen Abhängigkeit dieser
Funktionen von der rechten Gehirnhälfte beruhten, müsste eine
Verletzung eben dieser Hemisphäre bei Männern das räumliche
Vorstellungsvermögen stärker beeinträchtigen. Dies haben
wir kürzlich mit Tests zur mentalen Rotation untersucht. Bei einem
dieser Tests ließen wir einseitig Hirnverletzte an Strichzeichnungen
eines Handschuhs in verschiedenen Orientierungen entscheiden, ob ein rechter
oder ein linker dargestellt war, indem sie einfach auf einen von zwei
ausgestopften Handschuhen deuteten, die vor ihnen lagen. Beim zweiten
Test legten wir ihnen zwei dreidimensionale, zueinander spiegelbildliche
Körper vor und ließen sie Photographien dieser Körper
in verschiedener Lage dem realen Gebilde zuordnen. (Mit solchen nicht
verbalen Antwortverfahren lassen sich auch Patienten mit Sprachstörungen
testen.)
Wie erwartet, ergaben sich bei Probanden beiderlei Geschlechts infolge
einer Verletzung der rechten Hemisphäre niedrigere Testwerte als
infolge einer vergleichbaren Verletzung der linken. Wie ebenfalls angenommen,
schnitten Frauen beim Test der mentalen Rotation dreidimensionaler Körper
schlechter ab als Männer. Überraschenderweise hatte jedoch die
Verletzung der rechten Gehirnhälfte bei Männern keine größere
Auswirkung als bei Frauen - letztere waren dadurch mindestens ebenso beeinträchtigt.
Dieser Befund lässt vermuten, dass die üblichen geschlechtsspezifischen
Unterschiede bei derartigen Tests nicht eine Folge unterschiedlicher Dominanz
der rechten Hemisphäre sind; die besseren Leistungen der Männer
müssen folglich durch ein anderes Teilsystem des Gehirns vermittelt
sein.
Entsprechende Annahmen über eine größere funktionelle
Asymmetrie bei Männern hinsichtlich sprachlicher Fähigkeiten
beruhten auf der Beobachtung, dass bei ihnen Sprachstörungen (Aphasien)
nach Verletzungen der linken Hemisphäre häufiger auftreten als
bei Frauen. Deshalb meinten einige Forscher folgern zu dürfen, Sprache
sei bei Frauen stärker beidseitig organisiert. Allerdings ist diese
Schlussfolgerung problematisch - während meines zwanzigjährigen
Umgangs mit Patienten traten Aphasien bei Frauen mit Verletzungen der
rechten Hirnhälfte nicht unverhältnismäßig häufiger
oder seltener auf.
Sprach- und Bewegungsstörungen
Bei der Suche nach einer Erklärung entdeckte ich einen weiteren
eindrucksvollen ge-schlechtsspezifischen Unterschied in der Hirnorganisation
für sprachliche und damit verknüpfte motorische Funktionen:
Frauen leiden eher als Männer unter Aphasie, wenn der vordere Bereich
des Gehirns verletzt worden ist. Da örtlich begrenzte Schädigungen
innerhalb einer Hemisphäre bei beiden Geschlechtern zumeist im hinteren
Bereich des Gehirns liegen, könnte dieser Sachverhalt erklären,
warum Frauen insgesamt seltener von Aphasie betroffen sind. Sprachfunktionen
sind demnach bei Frauen nicht deshalb mit geringerer Wahrscheinlichkeit
betroffen, weil die sprachlichen Fähigkeiten bei ihnen eher gleichmäßig
in beiden Hirnhälften repräsentiert wären, sondern weil
die dafür kritische Region seltener verletzt wird.
Ähnliches zeigt sich in Untersuchungen von willentlichen Handbewegungen,
die von der linken Hemisphäre gesteuert werden. Apraxie - die Störung,
gewisse erlernte oder zweckgerichtete Bewegungen der Hände auszuführen
- tritt sehr häufig nach Verletzungen der linken Hemisphäre
auf. Sie ist auch eng mit Sprachproblemen verbunden. Nun beziehen sich
die von der linken Gehirnhälfte abhängigen kritischen Funktionen
möglicherweise nicht auf die Organisation von Sprache an sich, sondern
vielmehr auf diejenige der komplexen oralen und manuellen Bewegungen,
auf denen die menschliche Kommunikation beruht. Untersuchungen an Patienten
mit Verletzungen der linken Ge-hirnhälfte haben gezeigt, dass diese
Bewegungswahl bei Frauen eher mit vorderen Arealen zu tun hat, bei Männern
hingegen eher mit hinteren.
Die Nachbarschaft des Motorikwahlsystems zur unmittelbar dahinter
liegenden motorischen Rinde mag bei Frauen feinmotorische Fertigkeiten
begünstigen. Im Gegensatz dazu scheinen die motorischen Fertigkeiten
bei Männern Zielbewegungen in die Ferne - von sich selbst weg - zu
betonen. Es könnte dafür vorteilhaft sein, dass die zuständigen
Rindenregionen eng mit den visuellen Arealen vernetzt sind, die im hinteren
Bereich des Gehirns liegen.
Die stärkere Abhängigkeit der Frauen von den vorderen Hirnarealen
ist selbst dann erkennbar, wenn Tests eine visuelle Kontrolle erfordern
- zum Beispiel, wenn die Versuchspersonen ein zu betrachtendes Modell
mit Bauklötzen nachbauen sollen. Über eine solche komplexe Aufgabe
wird es möglich, die Auswirkungen von Läsionen der vorderen
und hinteren Gebiete beider Hemisphären zu vergleichen, da die Leistungen
sowohl durch Verletzungen der einen wie der anderen Hirnhälfte beeinträchtigt
werden. Wiederum sind Frauen durch Verletzungen vorderer Regionen der
rechten Hemisphäre stärker beeinträchtigt als durch solche
der hinteren. Bei Männern ist es im allgemeinen umgekehrt.
Wenngleich ich keine Anzeichen für Geschlechtsunterschiede in der
funktionellen Asymmetrie der beiden Hirnhälften hinsichtlich grundlegender
Sprachfähigkeiten, motorischer Wahl oder mentaler Rotation finden
konnte, gab es doch geringe Divergenzen bei abstrakteren verbalen Aufgaben.
Die Leistungen in einem Wortschatztest beispielsweise waren bei Frauen
durch Verletzungen jeder Hemisphäre beeinträchtigt, bei Männern
hingegen nur durch linksseitige Schädigungen. Dieser Befund legt
nahe, dass Frauen beim Nachdenken über Wortbedeutungen die Hemisphären
gleichmäßiger nutzen als Männer.
Im Gegensatz hierzu ist die Nicht-Rechtshändigkeit, die vermutlich
mit einer geringeren Dominanz der linken Gehirnhälfte zu tun hat,
bei Männern häufiger. Selbst unter Rechtshändern, berichtete
Marion Annett, sind Frauen quasi noch rechtshändiger -bevorzugen
also ihre rechte Hand noch mehr - als Männer. Es kann folglich sehr
wohl sein, dass Geschlechtsunterschiede in der funktionellen Asymmetrie
des Gehirns mit der speziellen untersuchten Funktion variieren und dass
nicht immer das gleiche Geschlecht die stärkere Asymmetrie aufweist.
Evolutionäre Grundlage der Geschlechtsunterschiede
Alles in allem weisen die Befunde aus verschiedenen Untersuchungen darauf
hin, dass die Gehirne von Männern und Frauen bereits von einer sehr
frühen Entwicklungsphase an nach unterschiedlichen Prinzipien organisiert
sind. Im Laufe der Entwicklung steuern Sexualhormone eine solche geschlechtsspezifische
Differenzierung. Ähnliche Mechanismen sind vermutlich auch bei der
Herausbildung von Unterschieden innerhalb der Geschlechter wirksam, da
es eine Beziehung zwischen der Konzentration bestimmter Hormone und den
kognitiven Leistungen im Erwachsenalter gibt.
Eine der faszinierendsten Erkenntnisse ist, dass kognitive Leistungen
während des gesamten Lebens hormonalen Schwankungen gegenüber
empfindlich bleiben können. Elizabeth Hampson hat gezeigt, dass
sich die Leistung von Frauen bei bestimmten Aufgaben während des
Menstruationszyklus mit dem Steigen und Fallen des Östrogenspiegels
ändert. Hohe Hormonkonzentrationen waren nicht nur mit ver-gleichsweise
verringertem räumlichem Vorstellungsvermögen, sondern auch mit
gesteigerter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit und motorischer Behendigkeit
verbunden.
Des weiteren habe ich bei Männern jahreszeitliche Schwankungen der
raumbezogenen Fähigkeiten beobachtet. Ihre Leistungen sind im Frühjahr
verbessert, wenn der Testosteronspiegel niedriger ist. Ob diese kognitiven
Fluktuationen auf eine bedeutsame Anpassungsfähigkeit hinweisen oder
nur Schwankungen über einem stabilen Basisniveau darstellen, bleibt
herauszufinden.
Um die kognitiven Leistungen des Homo sapiens als Individuum und Leistungsdivergenzen
zwischen dem weiblichen und dem männlichen Teil der Menschheit verstehen
zu können, dürfen wir sie freilich nicht nur unter heutigen
Lebensumständen beurteilen. Offenbar sind die Geschlechtsunterschiede
bei kognitiven Fähigkeiten deshalb entstanden, weil sie sich im Laufe
der Evolution als vorteilhaft erwiesen haben, und nicht, um lesen lernen
oder Computer bedienen zu können. Ihr Anpassungswert liegt wohl in
der fernen Vergangenheit begründet. Die Organisation des menschlichen
Gehirns hat sich über sehr viele Generationen durch natürliche
Auslese herausgebildet; Untersuchungen an fossilen Schädeln zufolge
ähneln die Gehirne heutiger Menschen im wesentlichen denen unserer
Vorfahren, die vor 50 000 oder noch mehr Jahren gelebt haben.
Die meiste Zeit seiner Entwicklung über lebte der Mensch in vergleichsweise
kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Die Arbeitsteilung zwischen
den Geschlechtern war in einer solchen Gesellung vermutlich recht ausgeprägt,
wie dies auch bei noch bestehenden Jäger-Sammler-Kulturen der Fall
ist. Die Männer gingen auf die Großwildjagd, wobei sie oft
weite Strecken zurücklegen mussten.
Zudem waren sie für die Verteidigung der Gruppe gegen Raubtiere
und feindliche Artgenossen verantwortlich sowie für die Herstellung
und den Gebrauch von Werkzeugen und Waffen. Die Frauen sammelten wohl
Nahrung in der näheren Umgebung, versorgten das Lager, bereiteten
die Nahrung, fertigten Kleidung an und kümmerten sich um den Nachwuchs.
Derartige Spezialisierungen erzeugten gewiss einen unterschiedlichen
Selektionsdruck. Die Männer waren auf Fähigkeiten angewiesen,
sich über große Entfernungen zu orientieren und (Rück-)
Wege zu finden, um ein Terrain aus verschiedenen Richtungen wieder zu
erkennen; und sie mussten gut zielen können, um genügend Tiere
zu erlegen. Wichtig für die Frauen waren eine Nahbereichsorientierung
- vielleicht mit Hilfe markanter Punkte - und feinmotorische Fertigkeiten,
die in einem eng umschriebenen Raum angewendet wurden, sowie die differenzierte
Wahrnehmung geringfügiger Veränderungen in der Um-welt oder
in der Erscheinung und dem Verhalten der Kinder.
Das Bestehen konsistenter und - in einigen Fällen - recht beträchtlicher
Geschlechtsunterschiede legt nahe, dass Männer und Frauen unabhängig
von gesellschaftlichen Einflüssen unterschiedliche Interessen an
Beschäftigungen und Befähigungen dafür haben können.
Ich würde beispielsweise nicht erwarten, dass beide Geschlechter
unbedingt gleichermaßen in Tätigkeiten oder Berufen repräsentiert
sind, bei denen es auf räumliches Orientierungsvermögen oder
auf mathematische Fähigkeiten ankommt wie bei den Ingenieurwissenschaften
oder der Physik. Doch würde ich mehr Frauen in der medizinischen
Diagnostik erwarten, wo Wahrnehmungsfähigkeiten wichtig sind. Selbst
wenn also jedes Individuum die Befähigung haben mag, sich in einem
für sein Geschlecht eher untypischen Gebiet zu bewähren, werden
viele Tätigkeitsfelder wohl nie von den Geschlechtern paritätisch
besetzt werden.
Quelle (Text und Bilder):
Spektrum der Wissenschaft 11/1992, Seite 104:
Doreen Kimura: "Weibliches und männliches Gehirn"
(gekürzt von Rudolf Öller)
Sex Differences in the Brain:
The Relation between Structure and Function. Herausgegeben von G. J. DeVries,
J. P. C. DeBruin, H. B. M. Uylings und M.A. Corner in: Progress in Brain
Research, Band 61. Elsevier, 1984.
Masculinity/Femininity.
Herausgegeben von J. M. Reinisch, L. A. Rosenblum und S. A. Sanders. Oxford
University Press, 1987.
Behavioral Endocrinology.
Herausgegeben von Jill B. Becker, S. Marc Breedlove und David Crews. The
MIT Press/Bradford Books, 1992.
Hormone.
Die chemischen Boten des Körpers. Von Lawrence Crapo. Spektrum der
Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg 1986.
Linkes - rechtes Gehirn:
Funktionelle Asymmetrien. Von Sally P. Springer und Georg Deutsch. Spektrum
der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg 1987.
|





