1) Der Begriff der Epigenetik
Der Begriff "Epigenetik" tauchte vor ungefähr einer Generation auf. Es entstand der Eindruck, dass es sich dabei um eine völlig neue Forschungsrichtung handelt. In Lehrbüchern vor den Achtzigerjahren sucht man den Begriff der Epigenetik vergeblich. Sogar im "Seyffert", dem größten deutschsprachigen Standardwerk der Genetik [3], kommt der Begriff "epigenetisch" nur an zwei Stellen, und hier auch nur in Nebensätzen vor.
Das Wort "Epigenetik" stammt von "Epigenese". Dieser Ausdruck war bereits im 18. Jahrhundert in Verwendung [1]. Es geht dabei um die Entwicklung von Embryonen zu fertigen Lebewesen. Die Biologen waren damals der Meinung, dass alle Merkmale des erwachsenen Organismus als Programm im befruchteten Ei angelegt sind. Dieses Programm wird nach und nach abgearbeitet, und das bezeichnete man als "Epigenese". Dieser Begriff tauchte in der Folge in vielen Biologielehrbüchern auch als Adjektiv auf: "epigenetisch".
Die Mitose ist ein Zellteilungsvorgang, der garantiert, dass nach der Befruchtung einer Eizelle das neu entstandene Genom vollständig an die Tochterzellen weitergegeben wird. Bei den höheren Tieren hat während der ersten Teilungsschritte jede einzelne Zelle die Möglichkeit, sich zu einem eigenen Organismus zu entwickeln. Das passiert beispielsweise bei eineiigen Zwillingen. Beide Individuen sind genetisch ident. Bei den nachfolgenden Zellteilungen kommt es schrittweise zu Differenzierungen. Die genetische Allmacht der ersten Zellen (Totipotenz) geht verloren und wird zur Pluripotenz.
Eines der ersten kompakten wissenschaftliche Werke über Epigenetik war das von Vincenzo Russo: "Epigenetic Mechanisms of Gene Regulation", erschienen 1996 bei Cold Spring Harbor Laboratory. In diesem Buch findet sich eine neue Definition des Begriffs Epigenetik, die mit der ursprünglichen Bedeutung nur noch wenig gemeinsam hat. Bei der "neuen" Epigenetik ging es plötzlich um vererbbare Veränderungen von Genaktivitäten, die aber keine Mutationen sind, sondern an- und abgeschaltete Strukturen.
Eine weiter gefasste Definition stammt von Conrad Waddington. Waddington definierte Epigenetik als "den Zweig der Biologie, der die kausalen Beziehungen zwischen Genen und deren Produkten beschreibt, die den Phänotyp hervorbringen". [12] Waddington hat die orthodoxen Neo-Darwinisten ein wenig geärgert, weil er zeigte, dass es interessante Rückkopplungen zwischen Phänotyp und Genotyp gibt. Das hat nichts mit Neo-Lamarckismus zu tun, auch wenn Waddington manchmal in diese Ecke gestellt wurde.
In der Folge kam es zu mehreren verwirrenden Definitionen, eine der neuesten - und noch relativ besten - lautet: "Epigenetik ist ein Zweig der Molekularbiologie, der sich mit allen Chromosomenbestandteilen, den Prozessen ihrer Veränderung während des Zellzyklus und der Zelldifferenzierung sowie mit den Auswirkungen dieser Prozesse auf den Phänotyp befasst." [2]
Ein einfaches Beispiel soll verdeutlichen, worin der Unterschied zwischen einer "epigenetischen Prägung" und einer Mutation liegt. Wenn in einer Textverarbeitung das Wort "Tor" fett, kursiv oder farbig erscheint, so bleibt das Wort "Tor" als Information erhalten. Es ist sogar möglich, einen Text auszublenden, ohne dass er aus dem Dokument gelöscht wird. Das wären epigenetische Prägungen. Wenn "Tor" zu "Tür" geändert wird, haben wir es mit einer Mutation zu tun, die negativ, vorteilhaft oder neutral sein kann.
Dass Gene an- und abgeschaltet werden, ist keine neue Erkenntnis. Das Lactose-Operon ist das System, an dem grundlegende Prinzipien der Gen-Regulation aufgedeckt wurden [3]. Francois Jacob und Jacques Monod entdeckten 1960 diesen Mechanismus, veröffentlichten ihre Ergebnisse 1961 und erhielten 1965 den Nobelpreis. Es war der erste Nobelpreis für die Beschreibung einer Steuerung der Genaktivität.
Es ist nicht nötig, genetische Mechanismen genau zu kennen, um zu verstehen, dass während der Embryogenese unzählige Gene gezielt an- und abgeschaltet werden. In allen Zellen eines Organismus liegt das gesamte Genom im Zellkern vor, aber in Nervenzellen sind ganz andere Gene aktiv als in Bindegewebszellen. In Muskelzellen kommen wegen des Energiebedarfs wesentlich mehr Mitochondrien und damit mehr ATP-Moleküle vor als in Epithelzellen. So gesehen ist Epigenetik ein großer Wissensbereich der die Gebiete Biochemie, Molekularbiologie und Molekulargenetik umfasst.
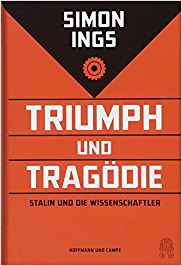 Während Darwins Theorien von Rassisten missbraucht wurden ("Überleben des Stärkeren"), war Lamarck der Favorit kommunistischer Ideologen. In der Sowjetunion unter Josef Stalin wurde Lamarcks Lehre als biologisches Dogma propagiert. Nicht nur das. Gregor Mendel stand im Kommunismus unter Generalverdacht, weil er Benediktinerpater und katholischer Prister war. Lamarcks Hypothesen hingegen wurden vom Biologen Trofim Lyssenko nicht nur verkündet, sondern auch "bewiesen". Seine Getreidezuchtmethode namens "Jarowisation" war eine Art früh-epigenetische Methode. Sie führte in eine wirtschaftliche Katastrophe und beschädigte die Landwirtschaft und die genetische Forschung in der Sowjetunion auf Jahre. [7] Während Darwins Theorien von Rassisten missbraucht wurden ("Überleben des Stärkeren"), war Lamarck der Favorit kommunistischer Ideologen. In der Sowjetunion unter Josef Stalin wurde Lamarcks Lehre als biologisches Dogma propagiert. Nicht nur das. Gregor Mendel stand im Kommunismus unter Generalverdacht, weil er Benediktinerpater und katholischer Prister war. Lamarcks Hypothesen hingegen wurden vom Biologen Trofim Lyssenko nicht nur verkündet, sondern auch "bewiesen". Seine Getreidezuchtmethode namens "Jarowisation" war eine Art früh-epigenetische Methode. Sie führte in eine wirtschaftliche Katastrophe und beschädigte die Landwirtschaft und die genetische Forschung in der Sowjetunion auf Jahre. [7]
Bild rechts: Geschichte der Naturwissenschaften unter dem Stalinismus.
Nachdem die ersten vagen Vermutungen aufgetaucht waren, dass Umwelteinflüsse das An- und Abschalten von Allelen beeinflussen könnten, gab es für eine Gruppe darwinkritischer Autoren kein Halten mehr. Um die Jahrtausendwende und im Jahrzehnt danach erschienen populärwissenschaftliche Bücher, deren Inhalte Biologen und Genetikern erschaudern lassen. Es ging dabei um nichts anderes als der Versuch, den Lamarckismus wiederzubeleben.
2) Lamarckismus und Darwinismus:
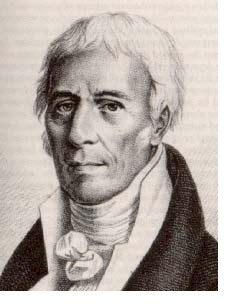 Der französische Naturforscher Jean Baptiste de Monet, Chevalier de Lamarck (1744 - 1829) war der Meinung, die Abstammungslehre behandeln zu müssen. Damit war er seiner Zeit voraus. Lamarck fasste Säugetiere, Vögel, Reptilien, Lurche und Fische in der Gruppe der "Vertebraten" (Tiere mit Wirbelsäule) zusammen. Die beiden anderen damals bekannten Tiergruppen der Insekten und Würmer nannte Lamarck "Invertebraten" (Nicht-Wirbeltiere). Lamarck erkannte später, dass diese Einteilung mangelhaft war. Seine eigenen Untersuchungen führten zu einer besseren Unterteilung des Tierreiches. So stellte er beispielsweise fest, dass man die achtbeinigen Spinnen nicht zu den sechsbeinigen Insekten zählen darf und dass die Hummer nichts mit den Seesternen zu tun haben. Im Zuge seiner Arbeiten entwickelte Lamarck ein verfeinertes Bild der Tierwelt und in der Folge die erste Evolutionstheorie. Der französische Naturforscher Jean Baptiste de Monet, Chevalier de Lamarck (1744 - 1829) war der Meinung, die Abstammungslehre behandeln zu müssen. Damit war er seiner Zeit voraus. Lamarck fasste Säugetiere, Vögel, Reptilien, Lurche und Fische in der Gruppe der "Vertebraten" (Tiere mit Wirbelsäule) zusammen. Die beiden anderen damals bekannten Tiergruppen der Insekten und Würmer nannte Lamarck "Invertebraten" (Nicht-Wirbeltiere). Lamarck erkannte später, dass diese Einteilung mangelhaft war. Seine eigenen Untersuchungen führten zu einer besseren Unterteilung des Tierreiches. So stellte er beispielsweise fest, dass man die achtbeinigen Spinnen nicht zu den sechsbeinigen Insekten zählen darf und dass die Hummer nichts mit den Seesternen zu tun haben. Im Zuge seiner Arbeiten entwickelte Lamarck ein verfeinertes Bild der Tierwelt und in der Folge die erste Evolutionstheorie.
Lamarck behauptete, die "marche de la nature" unterliege wenigen Gesetzen: Die Wirkung von Umwelteinflüssen auf die Entwicklung von Organen, die Veränderungen im Körperbau, die abhängig vom Gebrauch von Körperteilen seien, sowie die Vererbung erworbener Eigenschaften. Lamarck kommt der Verdienst zu, einen Weg gewiesen und den nachfolgenden großen Männern der Biologie wie Alfred Russell Wallace, Charles Darwin und Thomas Henry Huxley grundlegende Denkanstöße geliefert zu haben. Lamarck, der übrigens den heute üblichen Begriff "Biologie" prägte, starb verarmt 1829.
Lamarcks Lebenswerk darf trotz seines Irrtums (Vererbung erworbener Eigenschaften) nicht geschmälert werden. "Lamarck schrieb 1809 eine zweibändige ‚Philosophie zoologique' … Aber gerade dadurch wurde Lamarck zum Vorgänger Darwins, insbesondere der modernen Evolutionstheorie und damit der Biologie des 20. Jahrhunderts. Lamarck, Darwin und andere haben die neuzeitliche Biologie erst begründet." [10]
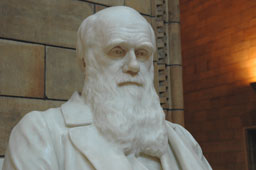 Charles Darwin entwickelte ein Konzept, das sich grundsätzlich bewährt hat: In der belebten Natur herrscht eine Vielfalt. Die jeweils besser angepassten Individuen haben eine statistisch höhere Chance zur Fortpflanzung als weniger angepasste. Charles Darwin entwickelte ein Konzept, das sich grundsätzlich bewährt hat: In der belebten Natur herrscht eine Vielfalt. Die jeweils besser angepassten Individuen haben eine statistisch höhere Chance zur Fortpflanzung als weniger angepasste.
Von einem "Überleben" des Stärkeren", wie das Sozialdarwinisten behaupten, hat Darwin nicht gesprochen. Leider kannte Darwin die Ursachen der (genetischen) Vielfalt nicht, also bediente er sich bei Lamarck, was Darwinkritiker nach wie vor süffisant anmerken.
3) Von der Epigenetik zum Neolamarckismus:
Der Genetiker weiß, dass man viele Individuen oft über mehrere Generationen gezielt einkreuzen muss, um den Erbgang eines bestimmten Allels auf die Spur zu kommen. Studien, die von lamarckistischen Epigenetikern als "Beweis" angegeben werden, taugen nicht einmal als Indiz. Eine Studie beschreibt beispielsweise einen Effekt in der Bevölkerung der schwedischen Stadt Överkalix: Die Ernährung der Großeltern, insbesondere der Großväter, kann sich angeblich im Phänotyp ihrer Enkel niederschlagen. Hatten Großväter in ihrer Kindheit einen reich gedeckten Tisch, dann erkrankten mit fortschreitendem Alter ihre Enkelsöhne an Diabetes. Kein Genetiker der Welt kann dies als Beweis für die Vererbung erworbener Eigenschaften gelten lassen.
Autoren mahnen zu großer Vorsicht: "Die Idee der Erblichkeit epigenetischer Eigenschaften ist faszinierend, doch erschwert sie auch Lösungsansätze und Vorhersagen für die Evolution genetischer Variabilität, wie sie bisher mit unseren klassischen Selektionsmodellen möglich sind." [4] An anderer Stelle schreiben sie ausdrücklich, dass der Verdacht der Neubelebung des Lamarckismus besteht: "Offensichtlich holt die Epigenetik Lamarcks Idee von erworbenen vererbbaren Eigenschaften zurück in die Genetik". [4]
Genau das versuchen einige Autoren, denen die Darwinsche Evolutionstheorie zuwider ist. Drei Bücher seien erwähnt, die von Fehlern und Missdeutungen nur so strotzen.
"Welche Rolle spielen die Gene? In den Medien werden sie vielerorts als die Verantwortlichen allen Übels hochgespielt". [5]
Von Genen als "Verantwortliche allen Übels" hat noch kein seriöser Genetiker gesprochen. Jeder Genetiker, der auch von Ökologie und Evolutionsbiologie eine Ahnung hat, weiß, dass Umweltbedingungen und genetische Vielfalt durch Anpassung und Selektion in permanenter Wechselwirkung liegen.
"Der alte Streit zwischen denjenigen, die Gene für die allein Verantwortlichen für alle Körpervorgänge halten, und den anderen, die Umwelteinflüsse für wichtiger halten, ist Schnee von gestern. Beide, Gene und Umwelt wirken zusammen." [5]
Dass Individuen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, ist längst bekannt und gründlich erforscht. Welche starke Wirkung die Umwelt hat, hat kein Geringerer als Charles Darwin im 19. Jahrhundert erkannt. Zur Erinnerung: Darwins Theorie ist eine Umwelt-Selektionstheorie ("Natural Selection").
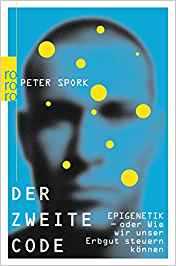 "Das Jahrzehnt der Genetik ist schon lange vorbei. Wir befinden uns jetzt mitten im Jahrzehnt der Epigenetik. In diesem Feld passieren derzeit die wichtigsten und aufregendsten Dinge der Molekularbiologie. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Denken in der Biologie, an der Schwelle zur postgenomischen Gesellschaft' … " [6] "Das Jahrzehnt der Genetik ist schon lange vorbei. Wir befinden uns jetzt mitten im Jahrzehnt der Epigenetik. In diesem Feld passieren derzeit die wichtigsten und aufregendsten Dinge der Molekularbiologie. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Denken in der Biologie, an der Schwelle zur postgenomischen Gesellschaft' … " [6]
Es gibt kein "Jahrzehnt der Genetik". Die klassische Genetik entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem die im 19. Jahrhundert von Gregor Mendel entdeckten Grundlagen der Genetik wiederentdeckt worden waren. Die Gentechnik entstand erst in den Neunzehnhundertsiebzigerjahren. Der Ausdruck "postgenomische Gesellschaft" ist nichtssagend. Er ist genauso unsinnig, wie es "postelektrische" oder "postchemische Gesellschaft" wäre.
"Die These von der … Epigenetik trifft mitten ins Herz der Biologie. Denn sie nährt den Verdacht, dass Jean Baptiste de Lamarck, der einstige Gegenspieler des großen Charles Darwin …" [6]
Hier wird die Katze aus dem Sack gelassen. Es geht um den Lamarckismus. Darwin war zudem kein Gegenspieler von Lamarck, sondern bediente sich mangels brauchbarer Theorien bei einigen seiner Hypothesen. Hätte Darwin Mendels Erbgesetze gekannt, dann hätte er den (vorläufigen) Schlussstein zu seinen Theorien gehabt, was er zu Lebzeiten vermisst hat. Lamarcks Hypothesen der Vererbung erworbener Eigenschaften wurden durch die moderne Biologie weitgehend widerlegt.
"… musste die Genetik bereits seit 1984 mit ansehen, wie einer ihrer fundamentalsten Grundsätze bröckelte: die Mendelschen Vererbungsregeln. Seit exakt 25 Jahren ist klar, dass diese Regeln nicht immer gelten." [6]
An den Mendelschen Regeln bröckelt nichts. Gregor Johann Mendel hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals aufgedeckt, dass Gene (er benutzte damals andere Ausdrücke) als diskrete Einheiten nach bestimmten Regeln von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Der Autor macht sich in seinem Buch über Gregor Mendel lustig, ohne zu wissen, dass die Mendelschen Regeln selbstverständlich nach wie vor gültig sind - mit den entsprechenden Erweiterungen der modernen Genetik. Wir haben in allen Wissensbereichen ähnliche Entwicklungen. Die Quantenphysik und die Relativitätstheorie gelten als Erweiterung der klassischen Mechanik, haben deren Gesetze jedoch nie ausgehebelt. Das Gleiche gilt für Mendel. Die moderne Genetik ist eine massive Ausweitung der klassischen Genetik, aber kein Genetiker denkt daran, Mendels Regeln für falsch zu erklären.
 Das dritte Mendelsche Erbgesetz, das heute noch unterrichtet wird, ist ein Sonderfall und gilt nur für nicht gekoppelte Gene (Genloci, die nicht auf demselben Chromosom liegen). Es sollte im Schulunterricht daher nicht besprochen werden, weil es Schüler mehr verwirrt als Zusammenhänge erklärt. Das konnte Mendel damals noch nicht wissen. In der Zwischenzeit hat sich viel geändert. Selbstverständlich gibt es Erbgänge, wie etwa die X-chromosomalen, die nicht den klassischen Mendel-Regeln entsprechen. Auch sind längst Mechanismen bekannt, die als "non Mendelian Heredity" in der Fachliteratur erwähnt werden. (Bild rechts: Mendel). Das dritte Mendelsche Erbgesetz, das heute noch unterrichtet wird, ist ein Sonderfall und gilt nur für nicht gekoppelte Gene (Genloci, die nicht auf demselben Chromosom liegen). Es sollte im Schulunterricht daher nicht besprochen werden, weil es Schüler mehr verwirrt als Zusammenhänge erklärt. Das konnte Mendel damals noch nicht wissen. In der Zwischenzeit hat sich viel geändert. Selbstverständlich gibt es Erbgänge, wie etwa die X-chromosomalen, die nicht den klassischen Mendel-Regeln entsprechen. Auch sind längst Mechanismen bekannt, die als "non Mendelian Heredity" in der Fachliteratur erwähnt werden. (Bild rechts: Mendel).
"Aber genau das bedeutet, dass unsere Evolution nicht nur, wie eben einst Charles Darwins Schüler propagierten und wir im Biologieunterricht lernten, durch jene zufälligen Mutationen erfolgte, sondern auch durch ständige Kommunikation mit der Umwelt." [8]
Hier wird ein Fehler begangen, der leider immer und immer wieder in populärwissenschaftlichen Büchern auftaucht. Der Autor schreibt zwar über die Evolutionstheorie, kennt aber keine Details. Darwins Theorie war eine Selektionstheorie, das kann man nicht oft genug wiederholen. Selbstverständlich hat kein Evolutionsbiologe jemals in Zweifel gezogen, dass die Umwelt eine bestimmende Kategorie in der Evolution ist.
"Lange galt es als ein Dogma der Biologie: Unsere Gene schreiben fest, wie wir sind, was für Fähigkeiten wir haben und welche Krankheitsrisiken wir haben. Heute weiß man: Diese Ansicht ist zu einfach." [8]
Es gibt in den Wissenschaften im Gegensatz zu Religionen und Ideologien keine Dogmen. Der Autor ist selbst Theologe, er scheint von der religiösen Dogmatik auf die Biologie zu schließen. Es gibt jedenfalls die Erkenntnis, dass wir Menschen von unseren Genen stark geprägt sind. Das ist unbequem, kann aber nicht einfach weggewünscht werden. Der Vorwurf, die Ansicht sei "zu einfach", ist obsolet. Es waren und sind die Biochemiker, Genetiker und Molekularbiologen, die längst klargemacht haben, dass die belebte Natur nicht "einfach" ist.
"Mit dem Vokabular seiner Zeit sprach Darwin von einem ‚Seelchen', das vom Körper in die Keimzellen geht. Das Seelchen war ein Stoff, eine Chiffre für etwas, das man nicht genau benennen konnte, ein Signal, das eben von der Körperzelle in die Keimzelle gelangt. Einzig die Neodarwinisten haben dieses Seelchen verbannt, weil sie offensichtlich nichts Umweltprägendes akzeptieren wollten. Mithin war schon Darwin – wie der französische Botaniker und Zoologe Jean Baptiste Lamarck – ein überzeugter Epigenetiker." [8]
Damit werden der Lamarckismus und groteskerweise der Darwinismus mit der Epigenetik gleichgesetzt. Es ist bis heute kein eindeutiger Fall einer induzierten, gerichtet auftretenden epigenetischen Vererbung beim Menschen bekannt. Ausschließlich phänotypisch orientierte Studien deuten eventuell in Richtung solcher Phänomene. So wird ein Einfluss der Ernährungssituation in Kindheit und Jugend auf Body-Mass-Index und Sterblichkeit bis in die Generation der Enkel beobachtet. Der molekulare Beweis für definierbare epigenetische Vererbung fehlt aber völlig. Die Mechanismen, wie epigenetische Effekte über Generationen beim Menschen weitergegeben werden, sind zwar Gegenstand aktueller Forschung – blieben bislang aber ohne konkrete Ergebnisse.
Der Umstand, dass bei einigen Pflanzenarten eine Vererbung erworbener epigenetischer Informationen möglich erscheint, befeuert die Phantasien und lässt einige Autoren die Epigenetik immer wieder in die Nähe des Lamarckismus rücken. Beispiele epigenetisch gesteuerter Vererbung in Pflanzen, falls sie überhaupt nachweisbar sind, sind jedoch auf die menschliche Vererbung nicht übertragbar. Diesen Fehler machen so gut wie alle populärwissenschaftlichen Autoren.
Die schärfsten Argumente gegen den Versuch, Epigenetik und Lamarckismus zu vermählen, finden sich bei Storch/Welsch/Wink. Bei Säugetieren wird die Vererbung erworbener epigenetischer Modifikationen unter anderem durch die Löschung (!) elterlicher epigenetischer Programme während der Keimzell- und Embryonalentwicklung sogar verhindert. Eine gerichtete Vererbung "erworbener" Eigenschaften ist daher bei Säugetieren (vermutlich auch bei anderen Tierklassen) auszuschließen: "Konzeptionell fehlt im Fall epigenetischer Vererbung eine Zweckgebundenheit, die für den Lamarckismus ein wesentliches Merkmal darstellt." [9]
Wenn erworbene epigenetische Markierungen eine evolutionäre Kraft sein sollen, müssten sie nicht nur auf den direkten Nachkommen übertragen werden, sondern stabil von den Nachkommen wieder auf deren Nachkommen - über viele Generationen hinweg. Für diese Vererbung epigenetischer Markierungen über Generationen hinweg gibt es - wenn überhaupt - nur schwache Hinweise. Auch wenn erworbene und vererbbare epigenetische Markierungen eine gewisse Rolle spielen sollten, so können dadurch allein keine völlig neuen Organe oder Systeme entstehen wie etwa die Wirbelsäule oder Flügel. Das geht nur über den zähen Prozess von Mutation und Selektion.
Die Epigenetik ist - nota bene – eine Kategorie der modernen Biologie, somit keine Pseudowissenschaft. Der Versuch jedoch, sie für einen Neolamarckismus einzusetzen bzw. zu missbrauchen und damit gleichzeitig die auf Darwins Theorien beruhende moderne Evolutionsbiologie auszuhebeln, darf als grandios gescheitert bezeichnet werden.
[1] R. Knippers: "Eine kurze Geschichte der Genetik"; Springer Spektrum (2012).
[2] V. Krauß: "Gene, Zufall, Selektion"; Springer Spektrum (2014).
[3] W. Seyffert: "Lehrbuch der Genetik"; Spektrum akademischer Verlag (2003).
[4] J. Tomiuk, V. Loeschcke: "Grundlagen der Evolutionsbiologie und formalen Genetik; Springer Spektrum (2017).
[5] J. Bauer: "Das Gedächtnis des Körpers" (Ut. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene Steuern), PIPER (2011).
[6] P. Spork: "Der zweite Code" (Ut. Epigenetik oder: Wie wir unser Erbgut steuern können), rororo (2011).
[7] S. Ings: "Triumph und Tragödie" (Ut. Stalin und die Wissenschaftler); Hoffman und Campe (2018).
[8] J. Huber: "Liebe lässt sich vererben" (Ut. Wie wir durch unseren Lebenswandel die Gene beeinflussen können); Zabert Sandmann (2010).
[9] V. Storch, U. Welsch, M. Wink: "Evolutionsbiologie" Springer Spektrum (2013).
[10] M. Neukamm: "Darwin heute" (Ut. Evolution als Leitbild in den modernen Naturwissenschaften); Wissenschaftliche Buchgesellschaft (2014).
[11] C. H. Waddington: "The genetic assimilation of the bithorax phenotype". Evolution 10, 1-13, 1956 |

![]() Epigenetik und Neolamarckismus in populärwissenschaftlichen Büchern
Epigenetik und Neolamarckismus in populärwissenschaftlichen Büchern